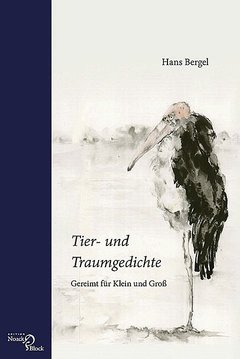Im Juli dieses Jahres wird der Dichter, Romancier, Essayist und Kulturhistoriker Hans Bergel 95 Jahre alt. Vor Kurzem ist sein Gedichtband „Tier- und Traumgedichte. Gereimt für Klein und Groß“ mit japanischen Tuschmalereien von Yoshie Terai im Berliner Verlag Noack & Block erschienen. Es ist ein Buch, das einen gleich mit dem ersten abgedruckten Gedicht, „Der kunterbunte Hund“, fasziniert und die unerschöpfliche Kreativität des Autors unter Beweis stellt:
Ich hatte einmal einen Hund,
der war zwar klein, doch kunterbunt.
Wenn ich ihn rief, dann war er blau,
und wenn er schlief, dann war er grau,
und wenn er bellte, war er weiß,
und wurde’s ihm beim Rennen heiß,
verfärbte sich orange sein Fell…
Er war ein seltsamer Gesell.
(„Der kunterbunte Hund“, S. 7)
Man könnte glauben, es ist ein Kindergedicht mit einem klaren Satzbau und einem unkomplizierten Reim. Der kunterbunte Hund verschwindet plötzlich eines Tages, was der Besitzer, alias der Dichter, bedauert, denn er ist sein lieber Freund und treuer Begleiter. Er fragt sich, ob er ihn wohl für immer verloren habe. Die Freude ist umso größer, als der Hund nach einiger Zeit wiederauftaucht und den Besitzer mit seinem Bellen um Mitternacht weckt. Liest man die letzte Strophe, so erkennt man die unverwechselbare sprachliche Finesse und meisterhafte Erzählweise Bergels. Das auf den ersten Blick einfache Kindergedicht enthält eigentlich eine tiefere Aussage, die Groß und Klein zum Nachdenken anregt:
Er trat zu mir ins Zimmer ein,
blieb bis zum ersten Morgenschein,
dann sagt’ er leis: „Ich geh jetzt fort
an einen unbekannten Ort.“
Er flüsterte – ich hört’ ihn kaum:
„Weißt du, ich bin ja nur ein Traum…“
Und so ist’s jede Nacht bei mir,
das kleine kunterbunte Tier.
(„Der kunterbunte Hund“, S. 8)
Und diese Schreibtechnik wird in den folgenden Gedichten fortgesetzt. Bergel lässt seine Tiere vieles erleben und erzählen, pendelt stets zwischen Realität und Fantasie, begibt sich gern in Traum- und Märchenlandschaften („War das ein Spaß, ihr lieben Leute! / Und wenn sie nicht gestorben sind, / dann tanzen sie noch heute.“ In: „Der Löwentanz“, S. 68), um Erkenntnisse und Weisheiten („Doch lassen wir sie jetzt allein / auf ihrer Regenwand’rung sein / und freu’n uns, dass wir warm und trocken / behaglich hier im Zimmer hocken, / Soll doch ein jeder wie er mag / verbringen seinen Regentag.“ (In: „Die Frösche und der Regenwurm“, S. 18) aus eigenen Lektüren und Reisen in die Gedichte einfließen zu lassen. Seine Ideale von Gedanken- und Bewegungsfreiheit dringen auch aus den gekonnten Kinderreimen hervor:
So rief der Storch und winkt’ mir freundlich zu,
und ich – ich habe plötzlich keine Ruh’ –
verwundert sehe ich: Mir wachsen Flügel,
und, heissa!, flieg ich über Meer und Hügel
und bin den weißen Störchen herrlich nah,
ich flieg mit ihnen bis nach Afrika!
(„Mit den Störchen nach Afrika“, S. 60)
Auch Eichhörnchen können wie die Menschen mal einen schönen Traum haben:
Ihm träumte, dass es Flügel hätte,
das Eichhörnchen im hohen Baum,
und dass es fliege um die Wette
mit einer gold’nen Fee im Traum.
(„Eichhörnchens Traum und der goldene Star“, S. 46)
Der alte Marabu hat sogar seine eigene philosophisch angehauchte Meinung, wenn es um Träume geht:
Da rief der alte Marabu
all den erschöpften Schwalben zu:
„Hört alle her, ’s ist nicht gelogen:
Auch ich bin übers Meer geflogen
und bin davon kein bisschen matt.
Was einer so vom Fliegen hat,
erfährt er auch im Schlaf und Traum –
ermüden wird er davon kaum.
(„Der alte Marabu“, S. 64)
Die Botschaft der Gedichte ist immer eine positive, hoffnungsvolle, lebensfrohe, menschenfreundliche:
Ja, ich denke stets daran,
was du sagtest, kleiner Mann,
an die Schönheit unsrer Welt,
die uns allen wohl gefällt.
(„Der Mann auf dem Mond“, S. 40)
Allen erwähnten Tieren werden menschliche Eigenschaften zugeschrieben, sodass die Gedichte oft Merkmale von Fabeln aufweisen, in einer zugänglichen, bilderreichen, lebendigen Sprache verfasst. So natürlich und ungekünstelt fließen der Reim und die Satzmelodie, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene beim Lesen Genuss und Vertrautheit empfinden:
Und drum sag ich euch beizeiten:
Viele Spinnenviecher breiten
ihre Netze aus und fangen,
wer zu arglos kommt gegangen.
Hütet euch vor ihren Fäden!...
Da gibt’s nicht mehr viel zu reden.
(„Die Spinne“, S. 20)
Das Besondere an den Tier- und Traumgedichten Bergels ist, dass man immer auch zwischen den Zeilen lesen sollte, denn es gibt Anspielungen, die einen wohlwollend belehren:
Drum eigne du dir diese Lehre an:
Erzürne niemals einen stolzen, großen, schönen Schwan.
Tust du’s - verzeih’n wird er’s dir nicht,
du bist für ihn ja nur ein ärgerlicher Wicht,
den man mit einem Schnabelkuss –
eins, zwei –
verschlucken muss.
(„Das Fischlein und der Schwan“, S. 54)
Aus den Versen spricht uns ein sehr guter Kenner der Menschen- und Tierseele sowie der Natur und des Lebens an, ein unermüdlicher Ästhet und Sprachschöpfer, für den die Reime kein schwerfälliges Korsett darstellen, sondern das Ergebnis einer soliden humanistischen Bildung und eines weiten kulturellen Horizonts sind. Wenn man das Gedicht „Der Mann auf dem Mond“ liest, assoziiert man es vielleicht spontan mit einem Mondgesicht oder erinnert sich an die Erzählung von Wilhelm Hauff und an das Märchen von Ludwig Bechstein. Sicherlich gibt es auch andere intertextuelle Bezüge zu Liedern oder Schlagern bzw. zum Film. Eigentlich ist es aber ein Gedicht, das die Menschen auf der Erde ermahnen will, auf ihre Umwelt besser zu achten und sich mehr für ihr Wohl einzusetzen.
Andere Gedichte sind ein Plädoyer für das Erhalten von mit dem Verschwinden bedrohten geistigen Werten wie Freundschaft, Liebe, Familie:
Dies ist die Zeit der Löwenbrut!
Hei, tut’s den Kleinen doch so gut,
den Löwenpapa bald ins Ohr,
die Löwenmama gar im Chor
in Nase und ins Knie zu beißen (…)
(„Der Löwentanz“, S. 67)
Bergels Band wäre vielleicht nicht entstanden, wenn es die zwei Enkeltöchter Gesine und Greta nicht gegeben hätte, denen das Buch gewidmet ist und die auch in dem Gedicht „Mit den Störchen nach Afrika“ (S. 59-61) liebevoll erwähnt werden:
Ich aber setz mich schnell ans Tischlein hin
und schreibe der Gesine einen Gruß –
ich schreib ihr, dass auch sie bald kommen muss.
Doch kommen soll sie nicht allein:
Bring Greta mit, dein Schwesterlein.
(a.a.O., S. 60f.)
Wie der schlaue Fuchs das im engen Garten eingesperrte Reh auffordert, ihm zu folgen, um sich am Glück der Freiheit zu freuen, so kann man den Vers „So komm mit mir, du wirst es nicht bereu’n“ („Das Reh und der Fuchs“, S. 50) als Einladung an die Leserinnen und Leser verstehen, die Hans Bergel mit seinen Gedichten artikuliert, um einen jeden in seine Gedanken- und Gefühlswelt eintauchen zu lassen. Und das geschieht in einer stilsicheren Sprache, in der lautmalerische Alliterationen, anschauliche Verben und Adjektive, passend gewählte Substantive mit Redewendungen, aphoristischen und sprichwortartigen Formulierungen alternieren:
Nun, freilich, meine ich bei mir,
so ist das auf der Erde hier:
Lebt jeder Mensch und jedes Tier
nach seiner eignen Art und Weise –
der eine laut, der andre leise.“
(„Der Rabe und die Spatzen“, S. 49)
Das Gedicht „Wolken“ ist, meiner Meinung nach, das Kabinettstück im Band. Darin finden wir die Verse: „Nein, wir können niemals stehen bleiben, / immer werden uns die Winde treiben.“ (S. 56) Die könnte man mutatis mutandis als Bekenntnis des Dichters deuten, denn so lange sein Herz schlagen wird, wird Hans Bergel schreiben, schreiben, schreiben. Ad multos annos!