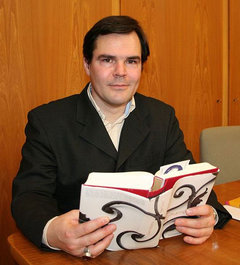Der 1968 in Dresden geborene Arzt und Schriftsteller Uwe Tellkamp erhielt 2004 den Bachmann-Preis (für die Erzählung „Der Schlaf in den Uhren“) und wurde später u. a. mit dem Deutschen Buchpreis, dem Deutschen Nationalpreis und dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgezeichnet. „Der Turm“, sein monumentaler Roman über die letzten Jahre des Sozialismus, über die „tausend Kleinen Dinge“, die so zwischen Geschichte und Märchenwelt herumliegen, über die stillstehende Zeit und ihre immerfort tickenden Uhren, über „die Wirklichkeit der Erinnerung“ und „die süße Krankheit Gestern“, wurde ein Bestseller.
Im vorliegenden Interview äußert sich Uwe Tellkamp zu seinem Verhältnis zum „deutschsprachigen Rumänien“, das ihn schon immer angezogen hat, zum „rumänischen Huhn“ der 80er Jahre, zur Zeit des Märchens (der „Immerzeit“) und zur Zeit des Alltags, zum mutmaßlich eigenartig klingenden Gefühl, “einen Teil meiner familiären Wurzeln in Rumänien suchen zu müssen“ – oder eben auch mal einfach zu Mircea Cărtărescus büffelgroßen Schmetterlingen.
Lieber Herr Tellkamp, „Der Turm“ wurde bereits – einschließlich der „süßen Krankheit Gestern“ – in viele Sprachen übersetzt. Mit seinen Bewohnern, den „Türmern“, dürfte das wohl freilich eine andere Sache sein. Wie wichtig ist Ihnen die Beibehaltung der im Deutschen mitschwingenden Konnotation des Türmens?
Der Turm ist als Begriff und Titel vielschichtig, das war mir wichtig. Ich mag Titel, die in die Kindheit, in die Begrifflichkeit der Märchen zurückführen, sie sind mit den unverlierbaren Eindrücken und Phantasien eines Alters imprägniert, in dem man die Dinge zum ersten Mal, und deshalb besonders prägend, erfährt. Titel wie etwa „Wie wir sind, können wir nicht ändern“ oder „Worüber wir reden, wenn wir über Liebe reden“ sind Erwachsenentitel, abstrakt, unanschaulich, uneinprägsam.
„Das Schloss“ oder „Der Zauberberg“ rufen ganz andere Dimensionen auf und an. „Der Turm“ assoziiert den Elfenbeinturm, in dem viele Bewohner meines Buchs leben, aber auch Gefängnis und das wehrhaft-starke Bauwerk, das übers Land blickt und Angreifer abwehrt. Am wichtigsten war mir die Beziehung zum Dornröschenmärchen. Dornröschen sticht sich im Turm der 13. Fee an einer Spindel und fällt, wie auch das Land, in einen hundertjährigen Schlaf. So kam mir der Sozialismus vor. Die Assoziation des „Türmens“ spielte demgegenüber eine untergeordnete, gleichwohl nicht unberücksichtigte Rolle.
Ihre „Geschichte aus einem versunkenen Land“ ist im gewissen Sinne die Geschichte vieler Menschen aus dem sogenannten Ostblock, eine Geschichte, in der man sich – oder etwa am liebsten die anderen – leicht erkennt, eine Geschichte, über die viele sagen können: Ja, so war das – auch wenn es ganz anders war; ein durchaus nachvollziehbares Zeugnis. Wann regte sich bei Ihnen der Verdacht, den Nerv der Zeit getroffen zu haben? Besser: Entstand erst der Verdacht oder war es von Anfang an Gewissheit?
Den Verdacht, einen Nerv der Zeit getroffen zu haben, hatte ich beim Schreiben nie, ganz im Gegenteil. Ich lebte in Karlsruhe, einer Stadt weit im Westen Deutschlands, in der sich so gut wie niemand für diese Geschichten interessierte und ich das Gefühl hatte, vom Mars zu stammen und ein Buch zu schreiben, das niemals verlegt, geschweige denn gelesen werden würde. Mich selbst hatte das Buch gefangen, ich spürte einen Sog, einen Zwang, es zu schreiben, ganz gleich, wie seine Erfolgsaussichten beschaffen waren. Es war zu guten Teilen meine Geschichte, und ich hatte das Gefühl: Wenn du dieses Buch nicht fertigbringst, werden dich seine Geister für immer verfolgen.
Schreiben Sie gerne aus dem Stegreif?
Nein, keineswegs, abgesehen davon, dass wohl jeder Anfang, sei es ein Satz oder ein Kapitel, gewisse Züge von Stegreifschreiben trägt. Wenn der Stift übers Papier spazierengeht, entsteht, was mich betrifft, schweifende, assoziative Prosa ohne Struktur, und je mehr ich fortschreite von Anfang zu Anfang, was heißt: von Text zu Text, desto stärker interessiert mich eine Prosa, die von der Schönheit der Sinngefüge, den Beziehungs- und Handlungsstrukturen, also dem „inneren Dessin“ lebt und weniger vom sprachlichen Bild, das lyrischen Ursprungs ist und in erzählender Prosa meiner Meinung nach nicht dominieren sollte.
„Brücken zwischen Bukarest und Prag und Warschau und Berlin“ schlagen: Ist das anhand des gemeinsamen Nenners des Zusammenbruchs eines Systems leichter als etwa Brücken zwischen Berlin und Berlin zu schlagen? Und: versunkenes Land vs. untergegangenes Land – sind die zwei Begriffe austauschbar?
Die Bewohner der Städte, die Sie beispielhaft nennen, teilen manche Erfahrung miteinander, das verbindet manchmal stärker als die (scheinbar) gemeinsame Sprache. Jeder, der den Sozialismus erlebt hat, ganz gleich, ob in Warschau oder Bukarest oder Leningrad, weiß etwas mit dem Begriff Stromausfall anzufangen, kennt das Schlangestehen vor den Geschäften, weiß, was sich hinter dem Begriff „Vitamin B“ („Beziehungen“) verbirgt, kennt die Aufmärsche vor Tribünen, die Indoktrination seitens eines absolutistisch verfassten Staates – kennt aber auch die schwejkschen Schlitzohrigkeiten, mit deren Hilfe es gelang, den Alltag zu meistern, weiß etwas anzufangen mit Improvisation und dem sonderbaren Phänomen, dass aus einer Glasmurmel eine ganze Welt steigen kann, dass die Intensität des Erlebens den Mangel wettmacht, ein einziger vergessener Farbtupfen in unseren aschegrauen Städten etwas Unvergessliches bedeutet hat, das sich Besucher aus dem saturierten Westen, der freilich seine eigenen, anderen Probleme hatte und hat, nur schwer erklären konnten.
Ein versunkenes Land ist eines, das nicht wieder auftaucht, ein untergegangenes Land könnte das, deswegen halte ich die beiden Begriffe auseinander. Ich glaube nicht, dass es etwas wie die DDR je wieder geben wird. Andere Gesellschaftsentwürfe sind denkbar, ich glaube, nicht so etwas wie die DDR. Aber wie sagt schon James Bond: Sag niemals nie …
Es gibt in Ihrem „Turm“ ein paar wenige explizite Rumänien-Bezüge – und sogar ein paar rumänische Wörter, etwa paşaport, papuci und priculici. Wo kommen die her? Was bewerkstelligen sie?
Der Turm ist auch Sprachen-Buch. Ihre Frage führt in die motivischen Tiefen. Geäußert werden diese Worte von einer alten Frau, die aus Siebenbürgen stammt, dessen Sprache sich, soweit ich weiß, mit Rumänismen durchmischt hat. (Jedenfalls hatte ich diesen Eindruck, wenn Oskar Pastior sprach – auch dann, wenn es nicht seine Gedichte waren, in denen er diese Durchmischung ja auch pflegt.)
Mich hat dieses Deutsch, das lange vom Wein einer anderen Sprache getrunken hat, immer schon fasziniert; vielleicht hängt das auch mit meiner Familiengeschichte zusammen, denn meine Großmutter stammte aus Schlesien, auch sie sprach ein solches in meinen Ohren merkwürdig klingendes, den Jungen, der ich war, überaus fesselndes Deutsch. Auch ganz Privates spielt eine Rolle.
Mich hat das deutschsprachige Rumänien, also das Banat, Siebenbürgen, das Buchenland, immer angezogen, ich konnte mir nie recht erklären, warum. Von meinem Großvater mütterlicherseits weiß ich absolut nichts, es gibt keinen Namen, kein Foto, keinerlei biografische Anhaltspunkte; meine Großmutter hat über ihn bis ins Grab geschwiegen. Eginald Schlattner sagte mir anlässlich eines Besuchs, ich hätte „so ein liebes Hermannstädter Gesicht“, und auch der Name Uwe sei für Siebenbürgen nicht so ungewöhnlich. Seltsam und bewegend für mich, dass er mir das sagte. Das mag für Sie etwas eigenartig klingen, aber ich hatte immer das Gefühl, einen Teil meiner familiären Wurzeln in Rumänien suchen zu müssen.
In der sozialistischen Atlantis versinkt nicht nur das DDR-Regime, sondern die Welt kommunistischer Diktaturen überhaupt, eine Welt, die einst sozusagen vom Elbischen Fluss bis zum Donaudelta (und darüber hinaus) reichte. Sie sprechen von einem tief in den mythologisch-märchenhaften Schichten des Romans versteckten Rumänienbild. Könnten Sie bitte näher darauf eingehen?
Auch Ihre Frage nach dem Rumänienbild des Buchs zielt in die Tiefen der Motivarbeit. Dieses Rumänienbild existiert ja nicht explizit, es ist verwoben mit dem für mich sehr wichtigen Märchengewebe, auf das alle anderen Schichten des Romans aufgearbeitet sind wie Ornamentik auf den Grund eines Stoffs, „Rumänien“ ist dann eher eine Metapher für „Märchen“, wie ja auch Ceauşescus Herrschaft etwas von einem finsteren Märchen hatte. Bauten wie der Palatul Parlamentului sind ja nicht mehr europäisch, sondern scheinen aus Vorzeiten aufzutauchen, aus der Welt der Pharaonen, der legendären Könige Assurs, und mich hat immer fasziniert, wie so etwas mitten im 20. Jahrhundert mitten in Europa möglich ist.
Der dritte Schwarzkönig des 20. Jahrhunderts, der Conducător, und die Schwarzkönigin, seine Frau, erschienen mir, was ihre Macht, ihre Handlungen und Wirkungen betrifft, eigentlich nur vergleichbar mit Pharaonen, deren Gottvertretung und Hohepriestertum, ja Gottgleichheit sie anstrebten.
Ein Thomas-Bernhard-Zitat: „Europa, das schönste [Märchen], ist tot; das ist die Wahrheit und die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, wie die Wahrheit, kein Märchen, und Wahrheit ist niemals ein Märchen gewesen.“ Stimmt das? Oder: Spricht Sie das an?
Thomas Bernhard verkennt eine entscheidend wichtige Wirklichkeit in seiner Aussage, nämlich die der Erinnerung, zu der ja alle Wirklichkeit, ist sie vergangen, wird. Ich glaube, er hat abseits seiner vielbeschworenen düsteren Kindheitserfahrungen von den Wirklichkeiten des 20. Jahrhunderts, gerade auch denen im Sozialismus, nicht viel gewusst. Nur so kann ich mir eine derart flache und ahnungslose Aussage erklären.
Märchen beschreiben doch nichts anderes als (verdichtete) Wirklichkeiten, genauer: Sie beschreiben das, was davon in den Vorstellungen der Menschen geblieben ist, und jede Wirklichkeit ist auch eine Wahrheit. Ist es kein Märchen, dass ein Schusterssohn aus Scornice{ti ein Imperium errichtet, in dem er sich als Sonne der Karpaten feiern lässt? Hat das sogenannte „rumänische Huhn“ der 80er Jahre, das nur aus Krallen und Hahnenkämmen zu bestehen schien, nicht das Ansehen eines ziemlich märchenhaften Tiers?
Ist die Errettung eines Mannes, der den Holocaust in einem Antwerpener Zoo unter Affen überlebte, als Mitglied ihrer Herde, nicht märchenhaft – nämlich dann, wenn etwas für die Wirksamkeit von Wirklichkeiten Entscheidendes hinzukommt: das Vergehen von Zeit, das ja auch nicht so ganz geheuer ist. Im übrigen würde ich solchen Äußerungen, gerade auch von Bernhard, der die pointierte Rede liebte, nicht allzuviel Bedeutung beimessen. Der Text „Amras“ ist ein zutiefst romantischer, also auch märchenhafter Text, und Bernhard hat ihn als seine Lieblingsarbeit bezeichnet.
Der Generationenkonflikt, der Vater-Sohn-Konflikt umspannt Ihren Roman in mehrfacher Hinsicht, besonders dramatisch etwa bei Altbergs indirekt geschildertem Vatermord, der eine – freilich verzerrte – Widerspiegelung der Ermordung Hildebrands durch Hadubrand darstellt. Schon im zweiten Kapitel des Turms wird im Vorfeld dieses hierin breit thematisierten Konflikts – zum Teil sogar auf gut Althochdeutsch – aus dem Hildebrandslied zitiert. „Ik gihorta dat seggen / dat sih urhettun / aenon muotin“. Oder: „sunufatarungo“. Das hört sich sehr urtümlich an. Wann beginnt Ihre Geschichte eigentlich?
Sie beginnt in der kreisenden, das heißt: allgegenwärtigen Zeit der Märchen.
„Aber man darf nur die Hälfte von dem glauben, was die Ärzte sagen, und wenn sie etwas schreiben, sollte man besonders misstrauisch sein“: So zitiert Altberg seinen Vater, den Apotheker. Sie, Herr Tellkamp, sind ein Arzt, der etwas zu sagen hat, und der das, was er zu sagen hat, sogar schreiben kann. Wieviel darf man, wieviel soll man von Ihren Geschichten, von Ihren Märchen, von Ihrer Wahrheit und Ihrer Wirklichkeit glauben?
Diese Frage beantworte ich mit einem verschwiegenen Lächeln, dem Lächeln der Geschichtenerzähler, die wissen, dass die Phantasie die Wirklichkeit von morgen sein kann, und die Wirklichkeit von gestern in unseren Erzählungen fortlebt. Mircea Cărtărescu schreibt in seinem Roman „Die Wissenden“ (Orbitor. Aripa Stângă) von büffelgroßen Schmetterlingen, die die aus Bulgarien kommende Sippe der Badislavs in der zugefrorenen Donau erblickt, und nachdem ich das, was er auf einzigartige Weise und mit größter poetischer Kraft schildert, gelesen habe, weiß ich, dass es büffelgroße Schmetterlinge gibt, deren Flügel weiches, essbares Fleisch haben.
„Übersetzer sind die genauesten Leser.“ Diese Worte lassen Sie Baron Arbogast aussprechen. Sie beziehen sich zu Beginn und dann wieder gegen Ende des Romans auf die „zwei Riesen“, die die Glocke auf dem Kroch-Hochhaus in Leipzig anschlagen. In Wirklichkeit schlagen die zwei Glockenmänner aber gar nicht die selbe Glocke an. Die große Glocke wird vom rechten Glockenmann angeschlagen, und die mittlere Glocke vom linken Glockenmann. Gehen hier Sein und Schein auseinander?
Bravo, Sie sind wirklich ein sehr genauer Leser. Diese Frage stellen Sie mir, ein Rumäne, nicht etwa ein Leipziger oder sonst überhaupt ein (deutscher) Leser! Zwei Riesen – zwei Zeiten: die des Märchens (die Immerzeit) und die des Alltags.
Mittlerweile wurden Inszenierungen des „Turms“ in Dresden und Wiesbaden aufgeführt. Geht etwas verloren, wenn man ihre monumentale Geschichte der “tausend Kleinen Dinge“, Ihre langatmigen Geschichten aus einem versunkenen (und von Ihnen nun gleichsam geborgenen) Land in zweieinhalb Stunden Bühnenzauber verpackt? Wird etwas gewonnen?
Dazu muss ich sagen, dass ich nur die Dresdner Inszenierung kenne, ich habe keine weitere Aufführung des dramatisierten Turm-Stoffs gesehen. In Dresden wird das Buch (und übrigens recht gut) auf seinen Handlungskern, die Szenen, zurückgeschnitten. Nun ist aber Handlung nicht alles, wie jeder Proust-Leser weiß.
Am Anfang hatte die Zeit Geduld mit den Menschen, so der 1980 verstorbene rumänische Erfolgsautor Marin Preda in seinem Roman „Moromeţii“ (Schatten über der Ebene). Auch in Ihrem „Turm“ sieht es am Anfang ganz so aus, als hätte die Zeit sozusagen sehr viel Geduld – und am Ende gibt es dann fast nur noch Snapshots. Die Zeit verliert ihre Geduld. Für wen schlagen Ihre Glocken, nein, Ihre Uhren?
Am Anfang scheint tatsächlich alles stillzustehen, man scheint durch Leim zu waten. Am Ende des Buchs rast die Handlung, rast die Zeit. Für wen? Ich fürchte, für die Epoche der Zahlen, die nach der mit den Umwälzungen von 1989 endenden Epoche des Sozialistisch-Atlantischen Reichs anbrach.