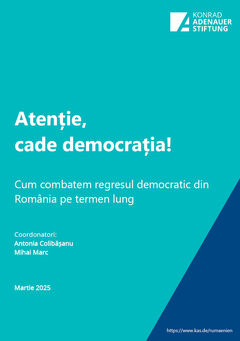Manchmal stolpert man bei einer Publikation über den Titel. So wie hier: „Atenție, cade democrația!“, auf deutsch wörtlich „Achtung, Demokratie fällt!“, so heißt eine aktuelle Broschüre der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Rumänien. Wobei das natürlich eine Anlehnung an die berühmten Hinweisschilder ist, die vor herunterfallenden Fassadenteilen von Gebäuden warnen. In diesem Sinne könnte man es auch mit „Achtung, die Demokratie bröckelt!“ übersetzen.
Die Broschüre, welche nur in rumänischer Sprache vorliegt, wurde in Anwesenheit mehrerer beteiligter Autoren am 26. März in der Aula der Zentralen Universitätsbibliothek Bukarest (BCU) vorgestellt. Sie beleuchtet verschiedene Teilbereiche des demokratischen Systems Rumäniens im Hinblick auf Dysfunktionalitäten und Fehlentwicklungen und formuliert konkrete Verbesserungsvorschläge. Für die einzelnen Kapitel zeichnen unterschiedliche rumänische Experten aus Wissenschaft, Medien und Zivilgesellschaft verantwortlich.
Die Publikation basiert auf einer zweigeteilten Diagnose, wie Mihai Marc, Programmkoordinator bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bukarest, erläutert. Zum einen seien da die systemischen Defizite, die keineswegs neu sind. Wenn man im Bild bleiben möchte, sind das die eingebauten Schwachstellen des demokratischen Hauses. Dazu kämen jedoch neue, gravierende Entwicklungen, die an dessen „Grundgerüst“ rütteln und zu einer echten Einsturzgefahr führen würden. Man könnte es auch so formulieren: Die herunterfallenden Fassadenteile sind aktuell deutlich größer geworden.
Broschüre und Veranstaltung kann man daher als eine Art Zwischenruf zum richtigen Zeitpunkt verstehen. Mihai Marc: „Rumänien kann es sich nicht mehr leisten, halbe Sachen zu machen und sich ‚durchzuwursteln‘ wie bisher, es muss grundlegende Reformen umsetzen, um sich selbst und seine EU- und NATO-Mitgliedschaft zu konsolidieren.“
Politik als Selbstbedienung
Den Anfang macht eine Art Überblicksartikel zur politischen Landschaft Rumäniens von Prof. Cristian Preda, Universität Bukarest, von 2009 bis 2019 Abgeordneter des EU-Parlaments als Teil der konservativen EVP-Fraktion. Preda geht dabei auf einige Punkte ein, die auf das Verhalten politischer Akteure (Politiker bzw. Parteien) im gegebenen System abzielen. Man könnte hier auch von (fehlender) politischer Kultur sprechen.
So argumentiert er zunächst, dass die rumänischen Parteien „ideologisch konfus“ seien – wo liberal oder sozialdemokratisch drauf steht, muss nicht unbedingt liberal oder sozialdemokratisch drin sein – und daher für die Wähler schwer greifbar. Dazu kommt, dass eben diese Parteien ihrer Rolle als verbindendes Element zwischen Bürgern und Staat nicht nachkommen würden. Stattdessen hätten sie sich abgekapselt und seien zu „Kartell-Parteien“ geworden, denen es vor allem darum geht, sich öffentliche Gelder zu sichern. Um den Wettbewerb um diese Gelder zu begrenzen, würden sich die Parteien sogar zusammenschließen – siehe die jüngste PNL-PSD-Koalition mit dem Modell der Regierungsrotation.
Innerhalb der Parteien gebe es häufig keinen echten Wettbewerb um den Parteivorsitz, die Macht konzentriere sich in den Händen der Parteichefs, welche wiederum ihre Position absichern würden, indem sie Gefolgsleute, „inkompetente Personen und/oder solche ohne Aufrichtigkeit, die in einer konsolidierten Demokratie, basierend auf Wettbewerb und Leistung, keine Erfolgsaussicht hätten“, mit attraktiven Ämtern versorgen.
Die Folge sei ein „tiefes Misstrauen gegenüber dem Staat“, der in der Bevölkerung „als Gegner und nicht als Beschützer des Bürgers gesehen wird“. Es liegt auf der Hand, dass es für dieses Problem keine einfachen Lösungen gibt, entsprechend fallen auch Predas direkt darauf abzielende Reformvorschläge eher knapp aus, z. B. rigide Vorschriften zur Verwendung öffentlicher Gelder durch Parteien und die Verabschiedung und Einhaltung von Ethikkodexen.
Eine missglückte Wahl
Natürlich kam die Diskussion über die „bröckelnde Demokratie“ nicht ohne einen genaueren Blick auf die Ereignisse rund um die geplatzten Präsidentschaftswahlen vom letzten Jahr aus. Zuständig dafür war Septimus Pârvu von „Expert Forum“ – ein Thinktank, welcher sich vermutlich als eine der „Soros-NGOs“ qualifiziert, auf die es Regierungschef Ciolacu neuerdings abgesehen hat.
Pârvu wies auf große Versäumnisse seitens der ständigen Wahlbehörde (AEP) hin, den Wahlkampf der verschiedenen Kandidaten – insbesondere dessen Finanzierung – zu beobachten und Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen. Konkret warf er der AEP vor, in der laufenden Kampagne die wöchentliche Berichterstattung zu Einkünften und Ausgaben der Kandidaten eingestellt und auf die Tatsache, dass Călin Georgescu weder das eine, noch das andere angab, nicht reagiert zu haben.
In der Broschüre geht er im Einzelnen auf die kontroversen Entscheidungen des Verfassungsgerichts („Präzedenzfälle für lange Zeit“) rund um die Präsidentenwahl 2024 ein – den frühzeitigen Ausschluss Diana So{oac²s, die Anordnung zur Nachzählung der abgegebenen Stimmen bzw. deren Auswertung kurz nach der ersten Wahlrunde und die Annullierung der Wahlen, beschlossen am 6. Dezember.
Dabei legt er an einigen Stellen den Finger in die Wunde: Das Untersagen der Kandidatur Șoșoacăs – Folge einer „moralischen Beurteilung“ vor dem Hintergrund der Verfassung, aber ohne Bezug auf konkrete strafbare oder der Wählbarkeit entgegenstehende Taten oder Aussagen. Zur Neuauszählung der Stimmen – deren Grundlage schon auf wackeligen Füßen stand – wurden keine Wahlbeobachter zugelassen, mit Ausnahme dort, wo diese es schafften, sich rechtzeitig einzuklagen.
Und vermutlich am gravierendsten: „Die Annullierung von Wahlen ist keine gewöhnliche und keine banale Entscheidung, vielmehr ist sie eine extreme, welche sehr gut begründet sein und auf unwiderlegbaren Beweisen basieren muss.“ Dieser Maxime, so war deutlich herauszuhören, sei das Verfassungsgericht nicht gerecht geworden, was zu einem weiteren Vertrauensverlust innerhalb der Bevölkerung gegenüber den Institutionen und dem Wahlprozess geführt habe.
Das Wahldesaster hat Pârvu zufolge klar gezeigt, dass die verschiedenen Prozesse, von der Zulassung von Wahlkandidaten, über eine mögliche Stimmnachzählung bis zur Annullierung, inklusive der Kompetenzen des Verfassungsgerichts dabei, besser gesetzlich geregelt werden müssen. Darüber hinaus brauche es politische Debatten, in denen ein Konsens darüber erzielt werden müsse, welche Voraussetzungen eigentlich ein Kandidat erfüllen bzw. wo genau der Betrug im Wahlkampf anfängt, der sanktioniert werden muss. Wie sieht es beispielsweise aus mit künstlichen Social-Media-Konten, die massenhaft Inhalte von bestimmten Kandidaten verbreiten?
Journalismus oder Parteienwerbung?
Im Rahmen der KAS-Veranstaltung gab es ohne Frage weitere aufschlussreiche Beiträge, die hier hätten besprochen werden können. Stattdessen soll jedoch abschließend auf einen Komplex eingegangen werden, der in der BCU nur am Rande diskutiert wurde, da die zuständige Autorin, Cristina Lupu, die Direktorin des Zentrums für unabhängigen Journalismus, bei der Veranstaltung nicht zugegen war. Der Titel ihres Kapitels lautet: „Presse: Unterordnung durch Subventionierung“ und damit ist der Punkt schon gemacht.
Wie wichtig dieses Thema ist, wird allein dadurch deutlich, dass es auch in weiteren Kapiteln der Broschüre – etwa bei Preda und Pârvu -, die sich nicht explizit mit der Rolle der Presse beschäftigen, auftaucht. Wenn auch in puncto Aufmerksamkeit aktuell übertroffen durch die Entwicklungen im Bereich der „sozialen Medien“ und insbesondere TikTok – auf der Konferenz mehrfach als kaum zu kontrollierender „Dschungel“ betitelt –, so haben eben auch die „klassischen“ Medien ihren Schaden angerichtet.
Genauer gesagt geht es darum, wie politische Parteien Medien nutzen, um ihre Botschaften zu transportieren. Bekannt ist, dass diese in den letzten Jahren extreme Summen staatlicher Gelder für Öffentlichkeitsarbeit aufgewendet haben. Lupu spricht von etwa 100 Mio. Euro an Subventionen in den letzten vier Jahren bezogen auf alle Parteien. Etwa 83 Mio. davon entfielen auf die PSD und die PNL. Noch nicht einmal enthalten darin sind spezielle Wahlkampfausgaben, die den Parteien erstattet werden.
Das Ausmaß ist die eine Seite des Skandals, die Art und Weise der Verwendung die andere. In erster Linie, weil niemand genau weiß, was mit dem Geld passiert. PSD und PNL, so schreibt Lupu, würden sich kontinuierlich weigern, Journalisten gegenüber offen zu legen, wofür genau diese Summen verwendet wurden. Die bestehenden Erkenntnisse beruhen vor allem auf investigativen Recherchen.
Diesen zufolge gehen große Summen der Parteien – auf unterschiedlichen Wegen – an Medien, von Fernsehsendern bis zu Zeitschriften und Onlineportalen. Teilweise sind PR-Agenturen dazwischen geschaltet, die die konkreten Aufträge erteilen und für die Abrechnung zuständig sind. Das Resultat sind laut Lupu Beiträge auf Bestellung politischer Parteien, teilweise ohne dass dies den Lesern oder Zuschauern gegenüber offengelegt wird.
Dieser denkt also, es handele sich um Informationen, die von unabhängigen Journalisten zusammengestellt wurden, während er in Wahrheit eine von Parteiinteressen bestimmte Perspektive präsentiert bekommt. In anderen Fällen würden die finanziellen Verflechtungen dazu führen, dass bestimmte von „alternativen Medien“ aufgedeckte Skandale auf den klassischen Kanälen totgeschwiegen werden. Die Folge – man beachte das Muster: „Das, was 2024 in Rumänien passiert ist, zeigt, dass die Überflutung der Öffentlichkeit mit intransparenten Geldern nichts anderes macht, als das Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu untergraben.“
Lupus Reformvorschläge beziehen sich auf eine Reduzierung der öffentlichen Gelder, die Parteien für Öffentlichkeitsarbeit ausgeben können und einen Zwang zur Offenlegung aller Empfänger öffentlicher Gelder, inklusive der „Endabnehmer“, wenn Agenturen dazwischen geschaltet sind. Aber auch bei der Kennzeichnungspflicht von politischer Werbung, welche bisher nur für den Wahlkampf klar geregelt sei, gebe es gesetzgeberischen Nachholbedarf.
Demokratie zum Mitmachen
Die Quintessenz von Broschüre und Veranstaltung ist vielleicht diese: An vielerlei Stellen des demokratischen Hauses muss in Bezug auf die geltenden Regeln und Gesetze, aber auch die Ausgestaltung politischer Institutionen, nachgebessert werden. Konkrete Vorschläge, die man im Einzelnen diskutieren kann, liefert die Publikation zur Genüge.
Noch entscheidender ist jedoch die Einsicht, dass Demokratie auf dem Engagement jedes Einzelnen basiert – entsprechend wird schon Konrad Adenauer in der Einleitung zitiert. Das Mitmachen und Mitgestalten beugt dem Vertrauensverlust vor. Wie Antonia Colib²{anu, politische Analystin in dem Unternehmen Geopolitical Futures, in ihrem Fazit formuliert, „ist es essenziell, dass wir verstehen, dass das demokratische System Rumäniens keine unveränderliche Selbstverständlichkeit ist, sondern eine Konstruktion, die permanent gefestigt werden muss“.
Aber wie kommen wir dahin, wohl wissend, dass bloße Appelle in der Regel verpuffen? Die Experten bringen hier verschiedene Aspekte ins Spiel. Colibășanu spricht von der Notwendigkeit einer anderen Debattenkultur, in welcher die drängenden sozialen Probleme dauerhaft und lösungsorientiert – unter Beteiligung der Gesellschaft – diskutiert werden.
Ein Kapitel des Universitätsprofessors Gabriel B²descu widmet sich dem Thema „zivilgesellschaftlicher Bildung“, welche auch als „Demokratieerziehung“ („educația pentru democrație“) bezeichnet werden könnte und auf der Förderung folgender Kompetenzen beruht: „die Fähigkeit zum kritischen Denken, effizient und konstruktiv miteinander zu interagieren und demokratisch zu handeln“.
Nicht zuletzt müsse die „Gemeinschaft“ als soziale Kategorie gestärkt werden, wie Codru Vrabie, selbstständiger Trainer und Berater für politische Initiativen, in der BCU forderte. Jenseits von Staat, Familie und Individuum als relevanten Kategorien, in denen Rumänen denken, müsse sich eine Ebene der Zivilgesellschaft eta-blieren, in der Bürger sich zusammentun.
Wie man wiederum mit politischem Engagement umgeht, das extremistische Positionen und Parteien stärkt und wo genau das demokratische System durch diese in Gefahr gerät, wäre vielleicht ein Thema für eine Folgepublikation.