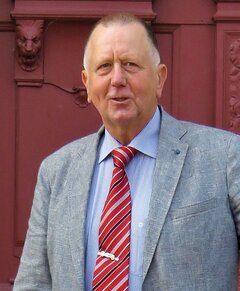Fotos erzählen Geschichten. Dessen war sich auch Dr. Jörg Biber bewusst, dessen Vater als Feinmechaniker während des Ersten Weltkriegs auf dem Luftschiffhafen Sanktandres/Szentandrás bei Temeswar/Timi{oara tätig war und eine umfassende Fotodokumentation zusammenstellte. Dr. Biber wollte das Andenken an seinen Vater und dessen außergewöhnliche Erlebnisse in einer Zeit rasanter technischer Entwicklungen bewahren. Aus diesem Grund vernetzte er die vielen Fotografien und Notizen seines Vaters mit seinen durch umfangreiche Recherchen gewonnenen Erkenntnisse in mehreren Büchern, die faszinierende Einblicke in das Leben der Luftschiffer im Banat sehr anschaulich verdeutlichen. Das jüngste Buch von Dr. Jörg Biber, „Luftschiffe über dem Balkan 1915 bis 1918: Erlebnisse von Feinmechaniker Paul Biber als Luftschiffer beim Königlich Sächsischen Luftschifftrupp Nr. 14“, kann übrigens auch im Erasmus-Büchercafé Hermannstadt/Sibiu oder in der Temeswarer Buchhandlung am Dom erworben werden. Anlässlich der Heimattage der Banater Deutschen im Juni soll dieses Buch auch in Temeswar vorgestellt werden, dazu werden mehrere Ereignisse zur 110-jährigen Luftfahrtgeschichte im Banat stattfinden. Im folgenden Interview berichtet Jörg Biber (74), der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, über das Wirken seines Vaters Paul Biber und die Bedeutung seiner Hinterlassenschaft. Die Fragen stellte ADZ-Redakteurin Raluca Nelepcu.
Ihr Vater, Paul Biber, war während des Ersten Weltkriegs als Luftschiffer im Banat tätig. Was hat Sie persönlich am meisten an seiner Arbeit fasziniert?
Wenn ich das Fotoalbum meines Vaters mit der Dokumentation seines Militäreinsatzes betrachte, dann erkenne ich sofort, dass er allseitig interessiert war – also sowohl technisch wie auch kulturell –, sich um ein gutes Klima unter seinen Elektrikerkollegen bemühte, den Kontakt mit der Bevölkerung gesucht hat und ihm auch der Kontakt mit seiner Familie wichtig war, er pflichtbewusst seine Arbeiten ausgeführt hat und stolz auf seine Leistungen im neuen beruflichen Metier der Elektrotechnik war.
Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde ich zusammen mit meiner Frau zu den jährlichen Treffen ehemaliger Schüler meines Vaters an der Deutschen Uhrmacherschule Glashütte eingeladen. Durch den Kontakt mit den Schülern und ihre Schilderungen zu Erlebnissen während ihrer Ausbildung habe ich vieles über meinen Vater erfahren. Einig waren sich alle Schüler darin, dass mein Vater durch sein ganzes Auftreten sich stets darum bemüht hat, sie zu human ausgerichteten, allseits gebildeten und handelnden Menschen zu entwickeln, die ihren Beruf in Einheit von Theorie und Praxis beherrschen.
Mein Vater verstand es in hervorragender Weise, Berufswissen zu vermitteln und immer wieder aufs Neue zu motivieren, neugierig zu machen, herauszufordern – ganz im Sinne von „Technische Probleme sind dazu da, um nach Lösungen zu suchen und diese zu erproben“. Paul Biber hatte einen „visionären Blick“ wie sich Feinmechanik entwickelt und wie die Ausbildung der zukünftigen Feinmechaniker zu gestalten ist. Diese Ausbildung von Berufsschülern, Meisterschülern und Fachschülern war seine Berufung. Ehemalige Schüler der Deutschen Uhrmacherschule Glashütte veranlassten nach der deutschen Wiedervereinigung, dass eine Tafel mit den Daten meines Vaters Paul Biber auf der „Ruhestätte verdienter Männer der Deutschen Uhrmacherschüler“ aufgestellt wurde.
Wenn die schon etwas betagten, ehemaligen Berufsschüler, Meisterschüler oder Fachschüler zum Vortragsabend anlässlich des 125. Geburtstages von Paul Biber, begleitet zur gleichnamigen Sonderausstellung, in der Diskussionsrunde ihre Ausbildung bei Paul Biber als eine Ausbildung für ihr ganzes Leben loben und dann sogar Fachschüler nach so vielen Jahren ihre exakten Mitschriften von den akribisch geplanten Lehrveranstaltungen von Dozent Paul Biber zeigen und betonen, dass sie diese in ihrer beruflichen Tätigkeit sehr gut gebrauchen konnten, dann ist mir so, als stünde mein Vater in diesem Raum seiner geliebten Uhrmacherschule und ist glücklich darüber, dass sich sein rastloses Schaffen für seine Schüler und seine Schule gelohnt hat.
Und ich merke, dass ich in meinem Berufsleben ein Teil von ihm war.
Wie sind Sie an das Fotoalbum mit den Erlebnissen ihres Vaters im Ersten Weltkrieg gekommen?
Das Fotoalbum meines Vaters mit Fotos und Erlebnisschilderungen von seinen Hauptstationierungsorten „Luftschiffhafen Temeswar“ und „Seeflugzeug-Versuchs-Kommando Warnemünde“ stand auf einem Hängeregal im Dachboden unseres Gartenhauses in Glashütte. Dieser Dachboden war zum Übernachten eingerichtet. Von hier oben hatte man einen herrlichen Blick ins Tal, in dem Glashütte lag. Setzte die Dämmerung ein, nahmen wir das Fernglas in die Hände und beobachteten auf der großen Wiese vor unserem Garten die Rehe, Füchse und Hasen.
Ja, in meiner Neugier hatte ich auch von Vatis Fotoalbum Besitz ergriffen. Da ich mit mich interessierenden Dingen immer sehr vorsichtig umging, hat mein Vater mich gewähren lassen. Ich war ja ein kleiner Bub, fuhr ab und zu mal im Tretauto und dann waren da in dem Album riesengroße Objekte, mein Vater sagte „Luftschiffe“ oder „Zeppeline“ dazu, in denen Menschen saßen und die am Himmel schwebten. Andere Objekte hatten große Flügel, die wurden „Flugzeuge“ genannt.
Mein Vater hat sicher versucht, mir das eine oder andere Flugzeug oder einen Zeppelin zu erklären. Ich, der da maximal sechs Jahre alt war, kann mich daran aber nicht mehr erinnern. Es ist auch schon um die 70 Jahre her. Die vielen Flugzeuge und Zeppeline haben mich seit dieser Zeit interessiert. Ab und zu habe ich mir dieses Fotoalbum zur Hand genommen und mir angeschaut, da lebte mein Vati aber schon längst nicht mehr. Ich habe das Fotoalbum immer in Ehren gehalten – ich besaß damit einen Teil meines Vaters.
Paul Biber war Feinmechaniker. Welche Einblicke können Sie uns in seine technische Arbeit geben? Gab es besondere Projekte, an denen er beteiligt war?
Mein Vater Paul Biber lernte Feinmechaniker und schloss im Mai 1910 seine Gesellenprüfung mit „sehr gut“ ab. Neben seiner Arbeit besuchte er fachliche Lehrgänge auf der Abend- und Sonntagsschule an der Gewerbeschule Dresden. So war es möglich, dass er in der Dresdner Firma Georg Rosenmüller, die u.a. Staudruck-Fahrtmesser, Anemometer (Windmesser) und Prandtlsche Staurohre zur Geschwindigkeitsmessung an Flugzeugen herstellte, schon ab 1913 als Techniker tätig war und als solcher als Werkstattleiter fungierte.
Mit Kriegsbeginn wurde er zum Militärdienst eingezogen und nach einer Grundausbildung dem Luftschifftrupp LT 14 zugeteilt. Da beim Abstieg, dem Manövrieren in Bodennähe und beim Aufstieg von Luftschiffen der Wind eine nicht unerhebliche Rolle spielt, gibt es auf einem Luftschiffhafen mehrere Windmesser. Bei der Instandhaltung von Windmessern wurden gern die Erfahrungen von Paul Biber genutzt.
Das im Aufbau befindliche „Seeflugzeug-Versuchs-Kommando (SVK) Warnemünde“ suchte Experten für die messtechnische Erfassung der Test- und Abnahmeflüge aller Marineflugzeuge. Auf Empfehlung von Dr. Rosenmüller, dem Sohn des Firmeninhabers, wechselte Paul Biber vom LT 14 zum SVK Warnemünde und war schon bald der Leiter der Versuchs- und Reparaturwerkstatt des SVK Warnemünde.
In dieser Funktion förderte er u.a. die Weiterentwicklung der Fahrtmesser (Firmen G. Rosenmüller und Askania), eine optimale Anbringung der Prandtlschen Staurohre sowie den Bau und die Erprobung eines künstlichen Horizonts mit Kreiselstützung.
Nach Beendigung seines Militärdienstes arbeitete Paul Biber bis zum 30. September 1921 wieder als Werkmeister bei der Firma „Georg Rosenmüller“ in Dresden. Er nutzte weiterhin Möglichkeiten der Abend- und Sonntagsschule zur beruflichen Qualifikation. So bestand er erfolgreich im November 1920 die Meisterprüfung für das Feinmechaniker-Handwerk. Davor, im September, hatte er seine erste Patentschrift „Einrichten und Messen von Keilwinkeln“ eingereicht.
Die Ausschreibung einer Anstellung als Werkstattleiter und Fachlehrer in der Abteilung Feinmechanik an der Deutschen Uhrmacherschule Glashütte gewann er und trat seine Stelle am 15. September 1921 an. Die Prüfungsanforderungen zum „Techniker auf dem Gebiet der Feinmechanik und Optik“ erfüllte er am 28. September 1922 mit „Vorzüglich“. 1925 stellte sich mein Vater den Herausforderungen der neuen Gewerbelehrer-Verordnung und durfte sich nun „Staatlich geprüfter Gewerbelehrer in der Fachrichtung Metallgewerbe“ nennen.
Mit der von Paul Biber geprägten Entwicklung der Abteilung „Feinmechanik“ zur zweiten tragenden Ausbildungssäule – neben der Abteilung „Uhrmacherei“ – an der Deutschen Uhrmacherschule Glashütte hat er sich zu einem Experten der Feinmechanik entwickelt. Seine vielen Erfahrungen flossen in seine Mitarbeit am „Taschenbuch der Feinmechanik“ ein, welches 1930 zusammen mit zwei dazugehörigen Beiheften erschien.
Wie war der Alltag Ihres Vaters auf dem Luftschiffhafen Sanktandres?
Nach dem Eintreffen des Königlich-Sächsischen Feldtrupps für Luftschiffe Nr. 14 mit dem Zug auf dem Anschlussgleis des Luftschiffhafens Temeswar musste der Landungstrupp zügig die Restarbeiten an der Luftschiffhalle ausführen. Diese waren am 28. Oktober 1915 beendet.
Entsprechend seiner beruflichen Ausbildung als Feinmechaniker und seiner Tätigkeit als Techniker bei der Firma „Rosenmüller“ in Dresden, seiner besuchten Weiterbildungskurse an der Städtischen Gewerbeschule Dresden in Vorbereitung auf die Meister- und Technikerprüfung, seiner hier gezeigten Arbeitsleistungen sowie der neu hinzugekommenen Aufgaben beim Betreiben des Luftschiffhafens Temeswar war Paul Biber ab sofort verantwortlich für die Funktionsfähigkeit der Anlage zum Erzeugen von Gleichstrom, einerseits für die Eigenherstellung von Wasserstoff in der „Gasanstalt“ und andererseits für die Beleuchtung der Luftschiffhalle, der Baracken sowie Stationen als auch das Betreiben der elektrischen Anlagen und Geräte der Rundfunkstation, der drahtlosen Telegrafenstation und der Blinkfeuer.
Die Sicherung der Energiebereitstellung, besonders für die Gaserzeugung, war also jetzt die neue Hauptaufgabe von Paul Biber. Aus Notizen von Paul Biber auf den Rückseiten der Fotos geht hervor, dass er an der Installation des Maschinenraumes mit beteiligt war. Er hat die Elektro-Fernleitung vom Maschinenhaus zur Gasanstalt zur Übertragung des erzeugten Gleichstroms errichtet.
Mit der Übernahme der Verantwortung für den ordentlichen Betrieb der Gleichstromerzeugung war der Tagesablauf klar vorgegeben. Jeden Tag, morgens um drei Uhr, startete für Paul Biber nun der Dienst im Maschinenraum zum Betreiben von Anlagen zur Erzeugung von Gleichstrom. Auch die Trafostation musste ständig kontrolliert werden. Sie sicherte, dass die Überführung des Gleichstromes vom Maschinenraum über die Hochspannungsfreileitung entlang der Landstraße bis zur Gasanstalt des Luftschiffhafens gelangte. Die Gaserzeugung erfolgte anfangs auch noch provisorisch im Freien.
Da die Tür zum Trafo-Raum den großen roten Blitz mit der Aufschrift „Lebensgefahr“ trug, trauten sich die Vorgesetzten nicht hinein. Er war somit „feldwebelsicher“. Im Traforaum haben es sich die Elektriker auch gut für ihren Aufenthalt eingerichtet. Auf dem Foto vom März 1916 lässt sich Paul Biber Speckkartoffeln schmecken, die sich in dem Topf befinden. Die hängenden Würste zeugen davon, dass er nicht Hunger leiden musste.
Darüber hinaus wurde mein Vater zusammen mit weiteren Elektrikern auch in Arbeiten zur Reparatur sowie teilweise Neuinstallation elektrischer und mechanischer Geräte eingebunden. In der Gesamtanlage des Luftschiffhafens gab es vielfältige elektrische Anlagen, die es zu installieren, zu betreiben und zu warten galt. Das hatte zur Folge, dass die „Elektriker“ zahlenmäßig ein ganz schönes Grüppchen bildeten.
Vielfach mussten sich alle Luftschiffer vom LT 14 (Landungstrupp und Schiffspflegetrupp) am Ein- und Aushallen der Luftschiffe beteiligen. Auch in die Instandhaltung bei Feindfahrten beschädigter Luftschiffe wurden Luftschiffer vom Schiffspflegetrupp, entsprechend ihren speziellen handwerklichen Fertigkeiten, eingebunden.
Zum Luftschiffhafen gehörte eine Kantine, die die Verpflegung der gesamten Hafenbesatzung übernahm. Im Fotoalbum meines Vaters ist auch ein Foto einer Ess- und Waschküche innerhalb der Unterkunft der Elektriker zu sehen. Damit kann davon ausgegangen werden, dass die Elektriker in gewissem Umfang Essen selbst zubereiten konnten. Neben der Luftschiffhalle haben die Luftschiffer Beete angelegt mit Tomaten-, Blattsalat-, Kohlrabi- und Gurkenpflanzen zur Eigenversorgung. Auch Obstbäume und Beerensträucher wurden dort gepflanzt.
Welche Bedeutung hat die Geschichte der Zeppeline für uns heute, Ihrer Meinung nach?
Bei der Teilnahme von Graf Ferdinand von Zeppelin als Kavallerie- und Generalstabsoffizier am Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 war Graf Zeppelin davon beeindruckt, wie die französische Seite Ballons zur Aufklärung und zur Sicherung der Verbindung zwischen dem belagerten Paris und dem Hinterland einsetzte. Daraus entwickelte Graf Ferdinand von Zeppelin (1838 – 1917) eine Idee, die ihn nicht mehr losließ – Bau eines Starrluftschiffes.
Erst nach seinem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Militärdienst konnte er sich systematisch der Arbeit an seinem lenkbaren Luftschiff widmen. Er entwickelte einen Plan zur Verwirklichung seiner Idee mit klar definierten Leistungsdaten. Die Grundlage seiner zielführenden Konstruktion bildeten der Verwendungszweck und die Leistungsdaten des Objektes in Form eines lenkbaren Luftschiffes. Er kämpfte für die Verwirklichung seiner Idee und setzte alle seine finanziellen Mittel ein. Graf Zeppelin war von der Umsetzung seiner Idee überzeugt. Am 2. September 1900 war es soweit: Das erste Starrluftschiff LZ 1 machte mehrere Probefahrten über dem Bodensee. Das Luftschiff LZ 1 beeindruckte mit vielen Konstruktionslösungen für ganz bestimmte Bauanforderungen, die für gleiche Anforderungen genutzt werden können – sogenannte Prinzipielle Lösungen – sowie dem Verdeutlichen von Schwachstellen. Zielstrebig wurden technisch immer hochwertigere Luftschiffe gebaut.
Graf Ferdinand von Zeppelin schuf mit der Gründung der „Deutschen Luftschifffahrtsaktiengesellschaft (Delag)“ am 16. November 1909 das erste zivile Luftverkehrsunternehmen der Welt. Er wollte mit der Schaffung eines Netzes an Luftschifffahrtsverbindungen die friedliche Nutzung der Luftschiffe demonstrieren.
Dieses Konstrukt „Zeppelin“ demonstriert doch sehr anschaulich die Bedeutung von Ideen, von Visionen, von zielführenden Konstruktionen. Wir brauchen, besonders in unserer gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Situation viele „Zeppeline“ – also viele Menschen mit Ideen, mit Kooperationsbereitschaft und Leidenschaft zur Ideenumsetzung.
Es muss dabei nicht immer ein Schneller, Höher, Weiter usw. geben. Der Mensch sollte sich auch Zeit nehmen, um in Ruhe die Schönheit der Natur mit dem gebührenden Abstand zu genießen. Welches technische Objekt eignet sich dazu außerordentlich gut? Genau, ein Zeppelin der neuesten Generation in Form eines Prallluftschiffes!
Deshalb nehme ich mir vor, mit meiner gesamten Familie im nächsten Jahr, anlässlich meines 75. Geburtstages, gemeinsam im Zeppelin NT eine Rundfahrt – sicher bei schönstem Wetter – über dem Bodensee zu unternehmen. Wir werden den Weitblick, das Gleiten durch die Luft und die herrliche Landschaft genießen. Für einen Augenblick wird der Luftschiffer Paul Biber ziemlich nah bei uns sein.
Sie sollen den Hinweis erhalten haben, dass es im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden eine kleine Sammlung an Fotos vom Königlich-Sächsischen Feldtrupp für Luftschiffe Nr. 14 während dessen Einsatz im Banat gibt, die bisher völlig unbekannt waren. Können Sie uns vielleicht einiges zu dieser Sammlung sagen?
Im Rahmen meiner Recherchearbeit hatte ich Kontakt zu einer Luftschiffarchiv-Plattform, dessen Betreiber, Andreas Krug, in Dresden lebt. Er informierte mich darüber, dass er zum Thema LT 14 im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden eine tolle Fotoserie gesehen hat, die viele Fotos auch zum Stationierungsort Temeswar beinhalten. Er zeigte mir ein Foto eines PKWs mit der Aufschrift „Luftschifftrupp 14“, der in der Temeswarer Feuerwache stand.
Dieses Foto hatte ich bei meinen vielen Recherchen noch nie gesehen. Er zeigte mir noch weitere Fotos von der Serie, die mir völlig fremd waren. Also suchte ich umgehend den Kontakt zum Militärhistorischen Museum der Bundeswehr. Über Dr. Bauer, den Leiter der Abteilung Museumsbetrieb, der mein Buch „Luftschiffe über dem Balkan 1915 bis 1918“ wie auch den Jahreskalender „110 Jahre Banater Luftschiffgeschichte“ für das Museum erhalten hatte und bestens eingeschätzt hatte, erhielt ich umgehend Kontakt zum Archiv. Mit Frau Barbara Maiwald, selbst Buchautorin, bekam ich eine sehr engagierte und fachkompetente Kontaktperson. Ihr war mein Buch bekannt. Sie gab mir bereitwillig Auskunft zu der gesuchten Fotoserie. Diese Foto-Sachen wurden 2001 als Nachlass Max Dutschke abgegeben und unter „Konvolut Max Dutschke“ abgespeichert. Da der Nachlass auch Negative enthielt, wurden von den Negativen auch Fotoabzüge erstellt. Manche der ungefähr 300 Fotos sind doppelt. Frau Maiwald geht von ca. 200 unterschiedlichen Fotos aus. Ein Großteil der Fotos ist digitalisiert. Teile vom „Konvolut Max Dutschke“ wurden nicht als Fotos vom Luftschifftrupp 14 ausgewiesen und somit auch bei Anfragen ans Archiv nicht präsentiert. Es hat den Anschein, dass der Großteil der Fotos von Max Dutschke bisher völlig unbekannt ist.
Als Frau Maiwald mir im Gespräch den Namen „Max Dutschke“ nannte, war ich hellwach und sagte: „Das war doch ein Freund meines Vaters“. Die beiden waren zusammen bei Temeswar stationiert und haben zusammen fotografiert. Das war wieder so ein glücklicher Zufall, den man ab und zu einmal braucht.
Diese Fotos zum Einsatz der Luftschiffer vom Luftschifftrupp 14 sind ja von allgemeinem Inte-resse für die Stadt Temeswar mit ihrer Umgebung sowie für alle Banater Schwaben. Da Herr Johann Janzer, der Sanktandreser HOG-Vorsitzende, auf den Fotos vom „Konvolut Max Dutschke“, besser als ich, erkennen wird, ob es sich auf dem Foto um eine Gegend aus dem Banat handelt, wird er nach Dresden kommen und wir schauen uns zusammen alle Fotos an.
Wir wollen zusammen eine Auswahl von Fotos treffen, die von allgemeiner Bedeutung fürs Banat sind. Eine Bildfreigabe und Bildübergabe sollen dann beantragt werden.
Andreas Krug gab mir noch einen weiteren tollen Hinweis. Frau Maiwald war so nett und hat entsprechend meiner Bitte ein Fotoalbum von Steuermann Willy Reuter für uns herausgesucht. Reuter war Steuermann auf den Luftschiffen LZ 81 und LZ 97, die beide über dem Balkan im Einsatz waren. Diese vielen, bisher unbekannten Fotos von Luftschiffen über dem Banat bzw. dem Balkan bilden sicher eine beeindruckende Basis für einen speziellen Bildband.