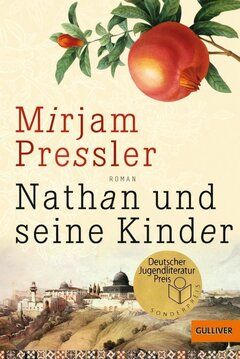Von Zugehörigkeit, Identität und zwischenmenschlichen Banden im Dreireligioneneck Jerusalem handelt dieser sensibel erzählte Roman, der kein Gegenstück zu Lessings Theaterstück „Nathan der Weise“ sein soll, wie Autorin Mirjam Pressler im Nachwort versichert. Doch „abgesehen davon, dass Menschen ungern Theaterstücke lesen“, schienen ihr Lessungs Figuren zu platt, zu sehr „im Dienst der Gedanken, die er verbreiten wollte“. Und auch die Charaktere kamen ihr zu kurz. So entschloss sie sich, die Geschichte neu zu erzählen: Mit hinzugefügten Figuren, eingebettet in eine soziale Wirklichkeit.
Da gibt es den Küchenjungen ohne Namen, den niemand bemerkt, ein Findelkind, gerettet vom ebenfalls neu in die Geschichte eingeführten Verwalter Nathans, Elijahu. Erst als Nathan ihm anbietet, sich einen Namen auszusuchen, weil dieser seinen eigenen nicht kennt - jeder ruft ihn bloß „Junge“ - wird er wahrgenommen. So heißt er nun „Geschem“ mit Vornamen, was Regen bedeutet, denn er liebt den Regen. Und „Ben Abraham“ mit Nachnamen, „denn wir sind ja alle Kinder Abrahams“, schlägt Nathan vor. Oder lieber Geschem Ibn Ibrahim, das muslimische Pendent dazu? Geschem, der neu Benannte, kennt seine Vorfahren nicht. Aufgewachsen ist er im jüdischen Haus von Nathan – doch macht ihn das zum Juden? Und: möchte er das sein? Erst als Elijahu ihn – ebenfalls auf den Rat Nathans – wie einen Sohn unter die Fittiche nimmt, fühlt Geschem sich wirklich zugehörig. Dann wohl doch eher Geschem Ben Abraham. Seinen Namen betrachtet Geschem als das größte Geschenk.
Dann gibt es noch Recha, Nathans Tochter – eine angenommene Tochter. Was Recha aber lange nicht weiß. Sie sei von einer sterbenden Christin geboren und zu Nathan gebracht worden, mit der Bitte, für sie zu sorgen. Das Findelkind erlöste Nathan aus dem Schmerz des Verlustes der eigenen Familie. Und natürlich wird Recha im Hause des Juden auch wie eine Jüdin erzogen. Doch als sie überraschend die Wahrheit erfährt, wird ihr der Boden unter den Füßen weggezogen. Ist sie nun Christin, weil als Christin geboren? Und der Tempelritter, der sie aus dem Feuer gerettet hat, kann der sie nun heiraten, und will er sie, nur, weil sie in seinen Augen jetzt auch Christin ist? Ist Liebe an Bedingungen gebunden?
Doch dann taucht der Tempelritter auf einmal im Palast des Sultans auf in neuen Kleidern, mit einem Turban auf dem Kopf. Nun wird klar, warum Saladin ihn als einzigen verschont hat, als er alle Tempelritter köpfen ließ: Der Sultan glaubte, in ihm den Sohn seines verschollenen Bruders Assad zu sehen!
Und in der Tat, auch der Tempelritter ist nicht der, der er anfangs zu sein scheint: nicht Curd von Stauffen. Diesen Namen hatte ihm sein Onkel verliehen, als er das Kind seiner Schwester zu sich nahm… Auch er ist also ein Verlorener, ein Suchender, ein Ausgestoßener in einer Welt, in dem sich Identitäten verwirrend mischen: das unbekannte Mitgebrachte, das Selbstgewählte, und das, was andere in ihm sehen.
Nathan der Weise zieht sanft an ihren Lebensfäden: Für ihn ist Liebe das höchste Gut, stärker als alle Blutsbande, und die drei Religionen nur verschiedene Formen, demselben Gott zu dienen.
Die Geschichte spielt etwa in den Jahren 1192/93, zur Zeit des dritten Kreuzzuges in Jerusalem, das 1187 von Sultan Saladin wieder zurückerobert worden war, nachdem es 88 Jahre unter christlicher Herrschaft gestanden hatte. Doch die Koexistenz der Religionen gelingt dort bis heute nicht. Obwohl dies kein großes Thema in der Literatur ist, ist Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise“ nach Goethes „Faust“ dennoch doch das zweithäufigst gespielte Bühnenstück in Deutschland. Mirjam Pressler erzählt den klassischen Stoff neu, provozierend zeitgemäß – und nicht ohne Hoffnung auf ein friedliches Miteinander.
Nina May