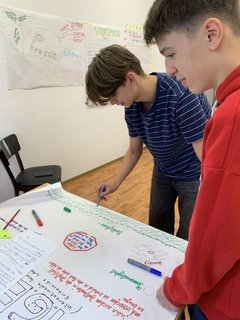„Fit fürs DSD“ - Rumänische Schülerinnen und Schüler lernen im Rahmen einer schüleraktivierenden Maßnahme (SaM), die von der Zentrale für das Auslandsschulwesen (ZfA) geplant und pä-dagogisch begleitet wird, in [umuleu Ciuc während eines viertägigen Ausflugs deutsche und rumänische Beispiele zum Thema „Ehrenamtliches Engagement“ kennen und setzen sich mit den Möglichkeiten des persönlichen Engagements auseinander.
Ehrenamtliches Engagement ist in Deutschland von besonderer kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Bedeutung. Mehr als 16 Millionen Deutsche engagierten sich 2023 ehrenamtlich, das waren über 20 Prozent der Bevölkerung. Ehrenamtlich tätig zu sein, bedeutet freiwillig und unentgeltlich beispielsweise in einem Verein oder bei einer Organisation zu arbeiten. Egal ob Sportvereine, kirchliche Einrichtungen oder Hilfsorganisationen - ohne ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre vieles von dem, was die Menschen in Deutschland als selbstverständlich erachten, nicht möglich.
Um die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements in Deutschland besser zu verstehen, haben sich achtzehn Schülerinnen und Schüler aus folgenden Schulen, die das Deutsches Sprachdiplom (DSD) anbieten und die der Initiative Schulen – Partner der Zukunft (PASCH) angehören, gemeinsam mit diesem Thema in [umuleu Ciuc im Kreis Harghita auseinandergesetzt: dem Nationalkolleg Ion Luca Caragiale, dem theoretischen Lyzeum Alexandru Vlahu]a aus Bukarest und dem Nationalkolleg Márton Áron aus Szeklerburg/Târgu Secuiesc.
Das Treffen fand während der sogenannten „Grünen Woche“ statt, die an vielen Schulen in Rumänien regelmäßig durchgeführt wird. Die Lernenden verbindet, dass sie alle an einer DSD-Schule im kommenden November das DSD der Stufe II der Kultusministerkonferenz ablegen werden. „Das Sprachdiplom ist mehr als nur eine reine Sprachprüfung. Es setzt kritisches Denken, Perspektivenwechsel und interkulturelles Verständnis voraus. Schülerinnen und Schüler sollten Bescheid wissen, was die deutsche Gesellschaft aktuell bewegt“, sagt Marina Pasquay, von der ZfA vermittelte Fachschaftsberaterin aus Bukarest.
Carol Szabolcs, Bundesprogrammlehrkraft am Nationalkolleg I. L. Caragiale in Bukarest, hat zusammen mit ihr das Programm für die vier Tage entwickelt. Gefördert wurde das Projekt finanziell von der ZfA. Wichtig war es den beiden Lehrkräften, dass den Teilnehmenden nicht nur Inhalte vermittelt werden, sondern dass sie die Möglichkeit bekommen, mit Freiwilligen aus Deutschland in Kontakt zu treten und handlungsorientiert zu arbeiten.
Die Schülerinnen und Schüler führten dazu unter anderem Interviews mit aus Deutschland stammenden „Kulturweitfreiwilligen“ zu Gründen und zur Motivation, in Kronstadt und Craiova ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Schulen zu absolvieren. Ebenfalls online zugeschaltet war Paul Kietzmann aus Hamburg, der aus seiner Tätigkeit als Freiwilliger in einer Förderschule berichtete. „Für mein Studium als Sonderpädagoge war das Freiwillige Soziale Jahr klar ausschlaggebend“, berichtete der Hamburger Student. Für die rumänische Seite war es teilweise sehr überraschend, dass sich viele Jugendliche in Deutschland nicht sofort nach dem Abitur für ein Studium entscheiden, sondern sich zunächst freiwillig engagieren und sich dadurch auch erproben können.
In einem weiteren Interview befragte die Gruppe Clemens Fritsch, den Vorstandsvorsitzenden des THW-Fördervereins Tempelhof-Schöneberg e.V. in Berlin und Helfer beim Technischen Hilfswerk (THW), zu seiner Motivation, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Interessant für die Schülerinnen und Schüler war dabei besonders, dass es sich beim TWH um eine Bundesbehörde handelt, die beim Zivil- oder Katastrophenschutz auf das freiwillige Engagement von weit über 85.000 Ehrenamtlichen zählen kann. Die Jugendlichen erfuhren, dass beim THW die Tätigkeiten und das soziale Miteinander zwar Freude bereiten und man viel über Sicherheit lernen kann, jedoch kann ein Ehrenamt schon zeitintensiv sein. „Familie und Freunde müssen öfter mal Verständnis zeigen, wenn der Dienst ruft“, erklärte Clemens Fritsch geduldig und mit sprachlichem Feingefühl.
Das Thema „Ehrenamtliches Engagement in Deutschland“ ist nämlich nicht nur konzeptionell schwierig für Deutschlernende. Auch sprachlich gibt es viele Hürden: Was ist eigentlich ein FSJler oder das FÖJ? Und warum steht bei FC Bayern München, genauso wie beim Deutschen Teckelklub 1888 oder beimDeutschen Roten Kreuz ein „e.V.“ am Ende? Auch diese Frage konnten die Elftklässler und Elftklässlerinnen abschließend beantworten.
Nach einer kleinen Informationsrunde zu den Voraussetzungen einer Vereinsgründung in Deutschland durften die Schüle-rinnen und Schüler selbst Konzepte für einen im Vereinsregister eingetragenen Verein (e.V.) erarbeiten und anschließend vorstellen. Wichtig dabei sei die Darstellung der Gemeinnützigkeit gewesen, mit der die Schülerinnen und Schüler zeigen konnten, dass sie das Konzept ehrenamtlicher Tätigkeit verstanden haben und sprachlich auch präzisieren können. Zu den fiktiven Vereinen zählten dann beispielsweise die Gründung der Internationalen Gemeinschaft für Erinaceidaes Leben (kurz I.G.E.L.) zum Schutze der kleinen stachligen Säugetiere. Bei dieser Übung mit fiktiven Vereinsgründungen zeigte sich, welches breite Spektrum an gesellschaftlich relevanten Themen die Jugendlichen interessiert. Von sportlichem über kreativem und karitativem bis hin zu integrativem Engagement: Jugendliche kennen die gesellschaftlichen Probleme und sie sorgen sich um ihre Gesellschaft.
Zwei Programmpunkte widmeten sich lokalen Beispielen, bei denen sich Menschen für eine nachhaltigere Gesellschaft engagieren. Peter György, Leiter des Jákab- Antal-Hauses in [umuleu Ciuc, in dem die Teilnehmenden untergebracht waren, berichtete den Jugendlichen auf Deutsch über die Tätigkeiten des von der Caritas unterstützten Bildungshauses. Für diese Unterkunft haben sich die beiden Lehrkräfte bewusst entschieden. „Nicht weil der Hausherr einwandfrei Deutsch spricht oder hier der Papst schon mal gegessen und geschlafen hat, sondern weil hier Menschen unterstützt werden, die es ansonsten schwer hätten, beispielsweise eine Berufsausbildung zu bekommen. Uns ist es wichtig, dass die Jugendlichen sehen, dass soziales Engagement zu einem nachhaltigeren gesellschaftlichen Zusammenhalt führt,“ sagt Carol Szabolcs. „Wenn Schüler mir sagen, dass ihnen beim Mittagessen aufgefallen ist, dass das Haus auch für die lokalen Bewohner offen steht, und hier der Polizist mit dem Bauarbeiter und den Touristengruppen zusammen isst, und sie alle das gut finden, dann hat sich die Wahl der Unterkunft definitiv gelohnt.“
Auch der Besuch des Sankt- Annen-Sees und die Führung durch das Torfmoor „Tinovul Moho{“ brachte die Schülerinnen und Schüler dazu, über die Bedeutung von aktivem Umweltschutz nachzudenken. Unkontrollierter Tourismus ist eine Bedrohung für die Pflanzen- und Tierwelt des Naturreservats. Dank des politisch-sozialen Engagements in der Gegend kann Besucherinnen und Besuchern nachhaltig der Zugang zu dieser einzigartigen Region gewährt werden.
Das Programm war eng getaktet und sicherlich ungewöhnlich für eine „Grüne Woche“. Denn wer fit für das DSD sein möchte, kam in dieser wunderschönen Umgebung auch nicht an einer für manche sicherlich körperlich anstrengenden Wanderung vorbei. Für viele war diese Woche nicht nur inhaltlich besonders, denn schließlich darf man nicht vergessen, dass diese Generation an Absolventinnen und Absolventen zwei wichtige Jahre ihres Lebens vermehrt vor dem Monitor klarkommen musste. „Auf Bildungsfahrten mit Klassen trauen sich leider immer noch zu wenige Kolleginnen und Kollegen. Die bürokratischen Hürden und die Verantwortung, die Lehrkräften aufgetragen wird, sind enorm. Man versteht, dass viele Lehrerinnen und Lehrer solche Fahrten meiden. Das ist bedauerlich,“ kritisieren die beiden Lehrkräfte aus Deutschland. „Es ist aber wichtig, dass schüleraktivierenden Maßnahmen wieder vermehrt stattfinden und außerschulische Orte zum Lernen genutzt werden. Nicht nur in der Schule darf gelernt werden. Schülerinnen und Schüler wollen raus, weil sie wissen, dass man auch außerhalb der Schule auf das Leben vorbereitet wird.“
Das zeigt auch die anonyme Evaluation der Fahrt. Auf die Fragen, was ihnen besonders wichtig war in Bezug auf die Prüfungsvorbereitung und was ihnen am besten an der Fahrt gefallen hat, antworteten mehrere Beteiligten, dass die konkreten Beispiele und der Kontakt zu den engagierten Menschen von Bedeutung waren, um das Konzept ehrenamtlicher Tätigkeit besser verstehen zu können — und die Bewegung in der Natur, fügten fast alle hinzu. Ansporn genug für die beiden vermittelten Lehrkräfte, solch eine Fahrt zu wiederholen.