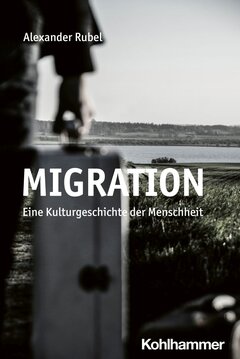Widerstehen wir zunächst der Versuchung, mit einem aktuellen Bezug zu beginnen. Alexander Rubel betrachtet sein 2024 im Verlag Kohlhammer erschienenes Werk gerade nicht als Beitrag zur aktuellen aufgeheizten Migrationsdebatte, vielmehr geht es ihm „um die vom Gegenwärtigen losgelösten Charakteristika von Migration, um die über Jahrtausende hinweg gültigen Muster, die grundlegenden Strukturen, nach denen Migrationsbewegungen gewöhnlich und typisch erfolgen“.
Dass er diese in seiner Einleitung sehr gelungen anhand des Grimmschen Märchens der Bremer Stadtmusikanten skizziert, sagt einiges über die Herangehensweise des Autors aus. Um es klar zu sagen: Es handelt sich um ein wissenschaftliches Buch. Alexander Rubel ist Direktor des Archäologischen Instituts der Rumänischen Akademie der Wissenschaften in Jassy/Iași sowie Leiter des Deutschen Kulturzentrums Iași – und selber Migrant, geboren und aufgewachsen in Deutschland, kam er Anfang der 2000er Jahre nach Rumänien.
Seine vorgelegte Arbeit knüpft in erster Linie an den wissenschaftlichen Diskurs und Forschungsstand verschiedener Fachrichtungen zur Migration an. Gleichzeitig geht es Rubel um „the bigger picture“, um nicht weniger als die Erzählung der Menschheitsgeschichte als Migrationsgeschichte. Dementsprechend fängt er auch ganz vorne an – und wirft am Ende doch einen kurzen, historisch geprägten Blick auf die gegenwärtigen Diskussionen über Migration.
Seine Synthese auf der Makroebene ist dabei gespickt mit individuellen Beispielen (Mikroebene) und Fallstudien zur Wanderung bestimmter Gruppen (Mesoebene). Exemplarisch sei hier nur ein gewisser Friedrich Trump aus der Pfalz genannt, der 1885 nach New York auswanderte und 1904 eigentlich in die Heimat zurückkehren wollte, was ihm von den dortigen Behörden verwehrt wurde – der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt.
Mit dem Buch möchte Rubel nicht nur wissenschaftliche Kollegen, sondern auch sogenannte interessierte Laien erreichen und es ist tatsächlich verständlich und anschaulich geschrieben. Im Grunde schlägt Rubel darin einen Perspektivwechsel vor, weg von der Fixierung auf Migration als neues „Problem“, hin zu einer Anerkennung von Migration als historischen Normalzustand. Er geht dabei soweit, zu behaupten, dass Migration nicht nur ein viel älteres Phänomen ist, als gemeinhin angenommen, sondern sogar ein „integraler Teil des Menschseins, unserer „conditio humana“ an sich.
Der Homo Migratius
Die Tatsache, dass Menschen schon vor Jahrtausenden migriert sind und sich an ganz neuen – weit entfernten – Orten niedergelassen haben, lässt sich heute anhand von DNA-Analysen von prähistorischen Knochen nachweisen. Die entsprechende Wissenschaft nennt sich Paläogenetik. Belegt ist auf diese Weise etwa die Wanderung von Ackerbauern aus Anatolien nach Europa ab ca. 6000 v. Chr., von Rubel als „erste große Migration der Menschheitsgeschichte (von der wir wissen)“ betitelt.
Unklar ist allerdings, warum sie dies taten. Rubel kommt in seiner Auseinandersetzung mit den frühzeitlichen Wanderungsbewegungen zu dem Schluss, dass diese durch objektive Kriterien (die berühmten Push- und Pull-Faktoren) nicht ausreichend zu erklären sind und bedient sich einer eher philosophischen Argumentation. „Der moderne Mensch, der ‘homo sapiens migrans’, brach zu neuen Ufern auf, weil er es konnte: weil er Handlungsspielräume nutzte und über ‘agency’ (Anm. des Autors: auf deutsch in etwa Handlungsfähigkeit) verfügte.“ „Pioniergeist“ und „Abenteuersinn“ würden die Menschen seit jeher prägen, das Bedürfnis, Neues zu entdecken, ist dieser Argumentation folgend quasi in uns angelegt.
Die Problematisierung von Migration
Warum sehen wir heute trotz dieser Befunde Migration in erster Linie als etwas Problematisches, als ein Abweichen von der Norm, dem sesshaften Leben? Rubel arbeitet hier eine überzeugende Erklärung heraus, die mit einer Art Selbstreflexion beginnt. Man müsse sich zunächst klar machen, dass unser Bild von Migration durch – grob gesagt – westliches Denken geprägt ist. Dieses – so analysiert Rubel weiter – basiere auf einer „Ideologie der Sesshaftigkeit“, welche „in direktem Zusammenhang mit dem Siegeszug des Bürgertums in der Neuzeit und der mit diesem Durchmarsch verbundenen Ausbildung des ethnisch begründeten Nationalstaats, der bis heute den Rahmen für kulturelle Einordnungen und historische Urteile bildet“, stehe.
Was hat also das Bürgertum damit zu tun? Laut Rubel sei dies maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich Menschen über ihr (unbewegliches) Eigentum definieren bzw. damit identifizieren. Mit der Entstehung des Bürgertums als dominierende gesellschaftliche Schicht im 19. Jahrhundert sei es für diejenigen, die dazu gehören wollten und konnten, notwendig geworden, ein Stück Land bzw. eine Immobilie zu erwerben. Nur indem sie vor Ort ansässig wurden, konnten sie die Aufnahme in die lokale Bürgergesellschaft sicherstellen. Parallel dazu erstarkte vielerorts die Idee von Nationen, die auf einen einheitlichen Ursprung zurückzuführen sind. Diese „Meistererzählungen“, von etwa den Deutschen, die in der direkten Tradition der Germanen stehen, waren politisch dienlich bei der Bildung von Nationalstaaten. Der Einfluss von Migration hatte darin keinen Platz.
Kulturelle Errungenschaften durch Migration
Rubel lenkt im Weiteren den Blick auf die positiven Folgen von Migration. Alleine dafür möchte man ihm heutzutage danken. Kulturelle Innovationen – und man muss hier von einem weit gefassten Kulturbegriff ausgehen – entstünden häufig (nur) durch „Kulturkontakte“, also das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen. Ermöglicht werden diese Kontakte durch Migration – man denke an die anatolischen Bauern, die ihre Erfahrungen mit dem Ackerbau in ein Gebiet mitbrachten, in denen sich die Menschen als Jäger und Sammler durchschlugen.
Dabei bleibt es in der Regel nicht bei einem einfachen „Kulturtransfer“, sondern es entsteht etwas Neues, Hybrides. Musikalisch detailliert schildert Rubel die Entstehung des Jazz um das Jahr 1900 in New Orleans, USA. Man möchte es nach der Lektüre dieses spannenden Kapitels nicht einfach in wenigen nüchternen Sätzen zusammenfassen. Vielleicht nur so viel: Die Wurzeln des Jazz gehen maßgeblich auf den „rhythmischen Arbeitsgesang“ der Sklaven auf den Plantagen Amerikas zurück. Welche weiteren musikalischen Elemente im Jazz zusammen kommen und wie dieser seinen Siegeszug startete, liest man am besten selber in Alexander Rubels Buch nach.
Unfreiwillige Migration
Mit dem Beispiel des Jazz legt Rubel das Augenmerk auf eine Form von Migration, die nichts mit dem oben besprochenen menschlichen Drang, Neues zu entdecken, zu tun hat. Die afrikanischen Opfer des nordamerikanischen Sklavenhandels sind mit Hilfe von Zwang und Gewalt zu Migranten geworden, für sie gab es keine Handlungsspielräume. Es zählt zu den Verdiensten des Buches, dass es sich auch mit den unterschiedlichen Abstufungen von Freiwilligkeit bzw. Zwang bezüglich der Auswanderung befasst.
Dabei helfen dem Autor im Übrigen die Protagonisten des Grimmschen Märchens: ein ausrangierter Esel, dem das Futter gestrichen werden soll, ein schwächlicher Jagdhund, den sein Besitzer totschlagen will, eine alternde Katze, abgehauen, um nicht ertränkt zu werden und ein Hahn, dem der Suppentopf droht. Gemeinsam machen sie sich auf nach Bremen, um dort Straßenmusiker zu werden. Weggehen mussten sie, um ihr Überleben zu sichern. Dass es dann irgendwie anders kommt, ist bekannt.