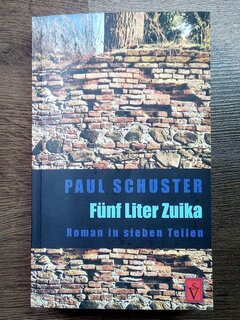Fünf Liter Zuika hatte die Maio auf das hohe Kellerregal gestellt, für die Hochzeit ihres ersten Sohnes. Übriggeblieben von der eigenen Hochzeitsfeier mit dem Schieben-Thummes. Da war von dem kleinen Thummes aber noch gar keine Spur… Um den besonders edlen Schnaps des rumänischen Schäfers Badea Mitru, in dessen Sennhütte sich Maria Katharina Krauß, genannt Maio, und Thomas Schieb alias Schieben-Thummes kennengelernt hatten, Zuflucht suchend vor einem Riesengewitter, rankt sich der Drei-Generationen-Roman von Paul Schuster, der Liebe, Leben, Alltag, Ehrgeiz, Hoffnungen und Zänke der Siebenbürger Sachsen in einem fiktiven Dorf namens Kleinsommersberg zwischen zwei Weltkriegen beschreibt. Zum Schluss bleiben allerdings nur drei Flaschen der hochprozentigen Köstlichkeit übrig. Und die Ungewissheit, ob der junge Thummes, inzwischen Absolvent des Gymnasiums, denn überhaupt jemals Hochzeit feiern wird, denn die Einberufung droht nun auch ihm...
Die Front im Osten stagniert und man munkelt, dass Hitler den Krieg gegen Russland vielleicht nicht gewinnen könnte – und ausgerechnet jetzt sollen sich die jungen Siebenbürger Sachsen „freiwillig“ melden… Nicht zur Wehrmacht, wie bisher, sondern gar zur SS. Weil nämlich SS-Soldaten von den Russen nicht gefangengenommen, sondern gleich umgebracht werden, was die Kampfmotivation ungleich erhöht. Was aber Gott sei Dank keiner der jungen Sachsen, um die es geht, realisiert... Sich als einziger in der Klasse dieser Pflicht entziehen? Unmöglich, denkt der Thummes, was wäre das für eine Schande? Und so nimmt er das Geheimnis der zweiten geleerten für seine Hochzeit bestimmten Zuika-Flasche mit sich – die erste hatte ihm als kleinem Jungen das Leben gerettet –, an deren Stelle jetzt eine wachsversiegelte grüne Glasflasche voll Wasser steht. Und die Erinnerung an seine beiden Lieben: die Heddiwi, das feine Fabrikstöchterchen, das ihr Vater nun erbost ans Meer verbannt hat, und die Finni, das Nachbars-Halbwaisenmädel aus seinem Heimatdorf, vor der er sich gerade unglaublich schämt. Weinend steht sie am Ende des Bahnsteigs an einen Baum gelehnt, als sein Zug ausfährt. Sie hatte ihn nicht vergessen…
Schicksalhaftes Unwetter
Wer die Abfahrt des jungen Thummes tragischerweise noch miterleben musste: der Großvater, der Schieben-Misch, der Vater vom älteren Thummes. Beginnt doch der Roman mit seiner eigenen Rückkehr von der Front des Ersten Weltkriegs. Hof und Garten findet er verwahrlost vor, seine Sara an Schwindsucht erkrankt, und sein Sohn, der jetzt „ältere Thummes“, immer noch verschollen im Krieg. Verzweifelt hoffen Misch und Sara, dass er bald heimkäme. „Dann könnt ich leichter sterben“, seufzt Sara. Und mit ihnen warten unzählige Frauen aus dem Dorf auf ihre verschollenen Männer oder Söhne. Das Wunder geschieht nur für manche: Der Thummes jedenfalls kommt aus Italien zurück, mit zerschossenem Knie zwar, leicht hinkend, aber am Leben! Aus dem sich seine Mutter bald verabschieden soll...
Aus bitterer Armut kämpfen sich der Schieben-Misch und der Thummes hoch: zum eigenen Grund bearbeiten sie auch noch die Gärten des Küsters und des Pfarrers zum Lohn der halben Ernte. Bald hält sogar eine Kuh auf dem Schieben-Hof Einzug, erstes Zeichen des Wohlstands. Jetzt müsste der Thummes doch endlich langsam ans Heiraten denken! Doch der stellt sich verstockt. Wer will schon einen hinkenden Ehemann?
Da kommen das Gewitter und der Schäfer ins Spiel – und ein verführerischer langer, nasser, schwarzer Zopf, der zum Trocknen aus einer Decke heraushängt. Die hat sich die besagte Maria Katharina Krauß aus dem Nachbardorf um ihre Blöße geschlungen. Bis ihr der Badea Mitru sein einziges Hemd leiht… Und so kommt es, dass auf eine sächsische Hochzeit, ganz ungewöhnlich, ein rumänischer Hirte, „ein Ciobane“, wie die Sachsen sagen, eingeladen wird. Wo doch „auf seine Hochzeiten der Sachs genauso stolz ist wie auf seine Kirchenburgen, seinen evangelischen Glauben und überhaupt auf seine ganzen achthundert Jahre“ im Karpatenland, so der Autor.
Kein leeres Land...
Ach, die Karpaten! „Für die ungarischen Könige waren sie achthundert Jahre lang ein Grenzwall, eine Bastion gegen alle Feinde, die ihr Land bedrohten, und um diese Bastion zu schützen, hat der ungarische König die Sachsen ins Land gerufen und ihnen ihre Privilegien gegeben“, fährt der Erzähler fort. „Für die Rumänen aber sind sie (die Karpaten) ein Rückgrat. Und das seit gut zweitausend Jahren. Alle lebendigen Wasser im Land strömen von ihnen zu Tal, vom Westen und Norden her nach Siebenbürgen hinein, im Osten durch die Moldau und im Süden durch den B²r²gan der Donau zu. Und an all diesen Wassern wohnen Rumänen. An ihren Quellen aber die Ciobani, die Schafhirten, die sich für den stolzesten Menschenschlag halten im ganzen Land. Selbst der ärmste unter ihnen trägt sich wie ein König.“… Eine Anspielung auf den landestypischen Dakerstolz? Denn weiter heißt es: „Sie, die Ciobani – so erzählt man sich – haben die Wege gefunden und gewiesen, nach denen der römische Kaiser Trajan seine Heeresstraßen gebaut , auf denen die Sachsen mit ihren Rumpelwagen und Rodehauen eingewandert (sind)…“. Von wegen leeres Land...
Und weil die rumänischen Schäfer mit ihren Herden je nach Saison bis nach Mazedonien hinunter, bis nach Polen hinauf und sogar bis in die Krim gezogen sind, hat so manches Muster aus fremdem Land die heimischen hölzernen Tore oder Trachtenblusen geziert, so „dass auch die Sachsen ihre rahmfarbenen, schafledernen Kirchenpelze nach ihrem Vorbild schmückten. Und wie stolz sie sind da-rauf! – Und wissen doch nicht, dass so manches Blümchen und Blättchen, das sie auf ihrem Pelz in die Kirche tragen, unter einem ganz anderen Himmel gewachsen ist.“
Jeder mit seinem Stolz
Aus diesen Hirtendörfern also stammt die feine Zuika, von der der Badea Mitru dem Schieben-Brautpaar ein paar Korbflaschen voll mitgebracht hat. Ein würdiges Geschenk für eine Hochzeit: beste Stirnzuika aus Pflaumen, vergoren im Eichenbottich, gebrannt auf unruhigem Akazienholzfeuer, nicht zu heiß und nicht zu lau, nur die erste Hälfte aus dem Kessel, „und nicht auch den Schwanz dazugepantscht, der alles verdirbt und verschandelt“.
So leben sie nebeneinander her, die beiden Völker, auch in Kleinsommersberg. Jeder mit seinem Stolz: „Die Sachsen haben ihre eigenen Gassen und die Rumänen ihre eigenen – damit man sich nicht vermischt. Und auch sonst haben sie alles extra, Kirche, Schule und Wirtshaus. Immer schon ist das so gewesen“, verrät der Erzähler. Nur selten schlägt einer aus der Art, wie der aus Amerika zurückgekehrte Nachbar der Familie Schieb, der Seiwerth Bill, der eine Rumänin heiratet, was sogar der sächsische Lehrer den armen ungetauften Hermann, den Sohn vom Bill und der Marioara, täglich bitter spüren lässt...
„Groß ist die sächsische Einheit!“
Wie es weitergeht mit dem Thummes und der Maio? Drei Kinder bekommen sie, und ein viertes, die Finni, ziehen sie ebenfalls groß, weil die arme Gret bei der Geburt gestorben ist. Vielleicht an Schwäche, vielleicht an Gram, denn die Sächsinnen sparten nicht an Kritik, als die Gret unverheiratet schwanger wurde. Was zählte es für die anderen, dass sie jahrelang nur auf ihren Pitter gewartet und keinen anderen angeschaut hat? Gewarnt hat man sie, dass sie als alte Jungfer übrig bliebe. Eines Nachts stand der Bräutigam dann, wie zuvor der Thummes, unter ihrem Fenster, und da ist die treue Gret halt vor lauter Freude ein bisschen vorzeitig schwach geworden...
„Groß ist die sächsische Einheit“, spottet der Erzähler launig weiter. „Nicht umsonst heißt es immer wieder von den Sachsen, sie wären ein Bollwerk. Bei allen feierlichen Gelegenheiten, bei den Geburtstagen von den berühmten sächsischen Männern zum Beispiel, wird über dieses Bollwerk geredet.“ Die Gemeinschaft: „ein schönes solides Gebäude, an dem jeder einzelne Stein an der richtigen Stelle sitzt“: Die Mädchen haben ihre Schwesternschaft und müssen der Altmagd parieren, die Burschen ihre Bruderschaft mit dem Altknecht an der Spitze, und über den beiden stehen die Magdmutter und der Knechtvater. Die Alten hingegen haben ihre Nachbarschaften, denen der Hann vorsteht, den Frauenverein, die Leichengesellschaft und die Adjuvantenmusik, alle mit ihrem Oberhaupt. Über all diesen Vereinen aber steht das Presbyterium mit den Kirchenvätern und dem Kurator an der Spitze. Höher steht nur noch der Pfarrer, und die Pfarrer gehorchen dem Bischof als allerhöchster Respektsperson. So ist das schon immer gewesen. Bis zwei Ereignisse die Bewohner von Kleinsommersberg spalten...
Käsbeutel, Kleefresser und die braune Welle
Da ist zum einen die neue Käsefabrik, für die beileibe nicht alle Sachsen arbeiten wollen. Statt dessen treten einige zu den Kleesamenzüchtern über. Fortan beschimpfen sie sich gegenseitig als „Käsbeutel“ und „Kleefresser“. Bis der Kurator „Frieden stiftet“: Zwar stört ihn nicht, dass der Thummes den Kleefressern vorsteht und er den Käsbeuteln, denn sächsische Organisationen haben sich schon immer vertragen. Was aber er, der Reicheln-Karl, gar nicht gebrauchen kann, ist ein Parteien-Krieg, in dem er das Ansehen der Gegenpartei verliert und mögli-cherweise nicht mehr gewählt wird. Da geht es um das Amt! Und für diesen höheren Zweck muss korrigierend intrigiert werden. Korrekter Sachse hin oder her...
Zum anderen aber nähert sich ein anderes, viel, viel größeres Übel: Unaufhaltsam schwappt es aus Deutschland heran, schleichend erfasst die braune Welle die sächsische Jugend, die es dorthin traditionell zum Studium verschlägt. Bald kündigen sich seltsame Besucher selbst im scheinbar unwichtigen Kleinsommersberg an – und die Schüler beginnen, statt wie bisher zu singen und zu turnen, zu marschieren und zu exerzieren. Nichts Ernstes, hatte doch vor Kurzem das „Tageblatt“ noch behauptet, dass „dieser Hitler“ wohl „irrsinnig wär und kein vernünftiger Mensch etwas auf diesen Nationalsozialismus gäb“...
Die Jugend organisiert sich. Erst kulturpolitisch, dann immer mehr politisch. Die braune Welle der Erneuerungsfront schwappt in die Kirche hinein, nicht einmal der Bischof kann mehr ein Machtwort sprechen. Altbewährte Strukturen zerbrechen. Der braune Schlamm wälzt alles nieder.
Ein „irreal reales Dorf“
„Sie kommen nicht als Feinde, sondern als Freunde! So stehts in allen sächsischen Zeitungen zu lesen.“ Und: „...der König (Carol II.) ist nach der Abdankung mit seiner unanständigen Frauensperson und über hundert Millionen mal wieder einmal irgendwohin gefahren, wo er sich besser verlustieren kann und keine Sorgen haben muss“, spöttelt der Erzähler weiter. „Der Marschall Antonescu aber hat gewusst, mit wem er es halten soll. Als General hat er halt Respekt gehabt vor dem Segen der deutschen Ordnung, und weil die Deutschen sowieso schon so viele Länder gesegnet haben… hat er sich halt gedacht: Ich halt es mit ihnen. Jetzt sind sie also da, die Deutschen. Mit ihren Kanonen und ihrer Militärmusik und ihren Zuckerln. Und es sind brave und lustige Burschen…“
Und dann ist es wieder so weit: Während draußen an der Front „kein Korn gemäht wird, sondern Menschen“... Während der Thummes auf dem Bahnhof steht, die Finni bitterlich weint und schon längst keine russischen Städte mehr „wie reife Zwetschken in Hitlers Schoß fallen“ – „hopp, schon ist Brest erobert“ – „hopp! Minsk“ – und „hopp! Odessa“– und „hopp! Kiew“… Und dann nichts mehr hopp – verrichten die Frauen die Feldarbeit, „und die jungen Mägde, die Großväter und die Invaliden aus dem Ersten Weltkrieg.“
Kleinsommersberg ist ein „irreal reales Dorf“, schreibt Olga Martynova im Nachwort. „Paul Schuster spricht über etwas, das zwar wirklich existierte“, doch „so, wie man listige Märchen erzählt, befremdet, an alles glaubend und gleichzeitig nicht glaubend, ohne das Erzählte zu verklären oder zu verurteilen.“
Top-Liste der „Versteh-Bücher”
Zweiter Weltkrieg
„Fünf Liter Zuika“ handelt zwar nicht in erster Linie über den Zweiten Weltkrieg – und doch steht es in meinem persönlichen „Regal der Pflichtbücher“ zu diesem Thema, die an allen Schulen durchgenommen werden sollten, ganz oben! Und zwar, weil es den Aspekt der Unausweichlichkeit der „braunen Welle“ in Siebenbürgen verdeutlicht: die einen, die sich begeistert davon erfassen ließen – und die anderen, die sich nur mit Mühe davor in Sicherheit bringen konnten, wie der junge Schieben-Thummes im Roman, wenn auch zuletzt vergeblich. Gleich daneben auf diesem „Regalbrett“ stehen – spannend, unterschiedliche Aspekte beleuchtend und ganz sicher zugänglicher als trockene historische Fakten und Daten – die folgenden, an der Realität inspirierten Romane:
• „Fuchsrot und Feldgrau“ von Axel Lawaczeck (siehe ADZ, 4. März 2022: „Der letzte Zug aus Galatz“),
• „Die Bücherdiebin“ von Markus Zusak, heutige ADZ, S.9, „Der Tod ist ein sanfter Erzähler“),
• „Ein Buch für Hanna“ von Mirjam Pressler (ADZ, 6. April 2024: „Endstation Schrecken in Theresienstadt“),
• „Selma Merbaum. Ich habe keine Zeit gehabt, zuende zu schreiben“ von Marion Tauschwitz (siehe ADZ-Interview mit der Autorin, 17. April 2024: „Ein Sehnen nach Menschen“. Selma Merbaum aus ‚Stefan Zweig‘“ und
• „Nacht“ von Elie Wiesel.