Sie halten zusammen. Obwohl sie, wie Pfarrerin Bettina Kenst es als Mitautorin des altersgerechten Lehrbuchs für die 3. Klasse bestätigt, ein „Randfach am Schultags-Ende“ unterrichten und „die Lehrkraft ein Clown“ zu sein habe, da man die Kinder anders nicht bei Laune halten könne. Allen Widrigkeiten zum Trotz aber „nehme ich vieles mit und lasse den Frust hier!“, empfand Religionslehrerin Franziska Riemer aus Kronstadt/Brașov, der Grundschullehrerin Martina Zey aus Sächsisch Regen/Reghin mit der Schlussfolgerung beipflichtete, dass es „sehr erfrischend“ gewesen wäre, „am Ende des Schuljahres hier zu sein“. 2024 hatte leider keiner stattgefunden, und „vielleicht haben Sie sich verwaist gefühlt, weil niemand nachgefragt hat“, so Gastgeber und Hausherr Reinhart Guib ehrlicherweise am Samstag, dem 31. Mai, im zweiten Stock des evangelischen Bischofspalais zur Eröffnung des Religionslehrerinnen- und -Lehrertages. Die Vakanz der Religionspädagogischen Arbeitsstelle der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) sei mit ein Grund für die Nicht-Einladung zur jährlichen Begegnung nach Hermannstadt/Sibiu gewesen. Mit dabei aber war erneut Dr. Angéla Deák aus Klausenburg/Cluj, und die reformierte Mittvierzigerin fühlt sich offensichtlich wohl als die neue Religionsunterricht-Beauftragte der EKR. „Das Curriculum ist sowohl Hilfe als auch Hindernis. An meiner Schule in Klausenburg gibt es zum Glück die Freiheit, den Lehrplan nicht streng einhalten zu müssen.“
Inhaltlich detailgenau auf die Finger schaut ihnen auch andernorts kaum jemand. Die „Freiheit“, von der Theologin Dr. Angéla Deák am János-Zsigmond-Gymnasium profitiert, ist ganz bestimmt kein Einzelfall. Sollte im deutschsprachigen Bildungszweig Rumäniens der auf Wunsch der EKR erteilte evangelische Religionsunterricht ein Zuviel an Katechese und Vernachlässigung von Schulung der Gesprächsfähigkeit in ethischen und moralischen Fragen mit sich bringen, beschwert sich im Teilnehmerfeld des letzten Mai-Tages am betreffenden Hermannstädter Bischofshaus niemand darüber. Mit dem Statement von Bildungs-Minister Daniel David wenige Tage zuvor auf der Nachrichten-Sammelstelle edupedu.ro, dass „Religionslehrer auch vom religiösen Extremismus und mehr auch von Ethik und Moral sprechen“ sollten, ist man stellvertretend für den politisch moderaten Anspruch der EKR einverstanden. Zumal der evangelische Religionslehrertag nicht Inhaltliches, sondern ein strukturelles Problem berührt: Inklusion. Allgemein überhaupt gar nicht einfach und im Religionsunterricht, dem „Randfach am Ende des Schultages“, noch viel schwerer zu leben. So diffizil, dass selbst Religionslehrerinnen und -Lehrer sich die Frage stellen, ob sie noch inkludiert sind.
Der Weg der Mitte
Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Siebenbürgen und Bukarest kritisch vorbringen, steigert sich knapp zur Kaskade. Denn die Leitkultur Rumäniens ist orthodox und die Referenz des aktuellen EKR-Religionslehrer-Tages das bundesdeutsche Vorbild von Inklusion. Gast Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke vom Institut für Evangelische Theologie an der Universität Paderborn hingegen, der tags zuvor eine Vorlesung für den Protestantisch-Theologischen Studiengang an der Lucian-Blaga-Universität gehalten hat (die ADZ berichtete), macht den sich zum Thema Inklusion Fortbildenden ein enormes Kompliment: „Wie viele tolle religionspädagogische Ideen hier aufgeploppt sind!“
Im deutschen Sprachraum Europas gilt der Schluss von Vers 28 des 10. Kapitels aus der Apostelgeschichte des Lukas als ökumenischer Monatsspruch im Juni: „Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf.“ Nichtsdestotrotz „ist Judas immer dabei!“, betont Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke nach einem „religionspädagogischen Experiment”, wozu er aufgefordert hatte. Mit Erfolg, denn sein Vorschlag, „in 55 Minuten Gottesdienst vorzubereiten und zu feiern“, begeistert auf Anhieb. Drei Gruppen, wovon jede einen von drei Teilen des Juni-Monatsspruchs bedenkt, besingt und bespricht, feiern „das Überschreiten von Grenzen, die wir uns selber gesetzt haben.“ Fast sofort anschließend setzt Marie Luise Schlierkamp, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Evangelische Theologie an der Universität Paderborn, zum Vortrag über „Inklusion in der Schule am Beispiel des Religionsunterrichts“ an.
Sie hat sich viel vorgenommen, fragt aber zunächst aus Höflichkeit, „was euer Inklusions-Verständnis in Rumänien ist?“, und stößt die Türe zum Ansprechen etlicher Mängel und Missstände auf. Völlig unwissend, natürlich. Doch es zeigt sich, dass das bundesdeutsche Muster schulischer Modalitäten wie beispielsweise der „Erstellung von Arbeitsmaterialien für drei unterschiedliche Niveaus“ sich auf die Bildungsbranche in Rumänien nicht einfach durch Knopfdruck übertragen lässt. Hierzulande würde an der Schule „grundsätzlich nicht differenziert“, hält Franziska Riemer ein, Schüler wären das gar nicht gewohnt, und „zudem fördert das Konflikte“. Angelika Beer, die in Malmkrog/Mălâncrav häufig Simultanunterricht gibt, versucht dort „zu verhindern, dass man einander mit Wörtern wie etwa ´ja, der kann das eben nicht´ beschreibt.“ Und man müsse als Lehrerin „unglaublich viel Disziplin aufbringen, um den Schülern Zeit zu geben, ihnen Zeit zum Lernen zu geben. Das gibt es oft nur im Religionsunterricht“, stellt Martina Zey klar. Wäre er doch kein „Randfach“!
Negatives Erstaunen der Nachfragenden aus Deutschland handeln sich die Lehrerinnen und Lehrer mit dem rumänischen Kürzel CES ein: Anrecht auf ganz persönliche Sonderunterstützung durch einen Hilfspädagogen zusätzlich zu den Erwachsenen, die sich wie üblich um die gesamte Klasse kümmern, hat erst, wer für sein Kind in der Schule Aufnahme in die Kategorie „cerințe educaționale speciale“ erwirkt. Was genau das bedeutet, kann Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke als Nicht-Versteher des Rumänischen bloß vermuten. Doch allein schon nur am scharfen Klang der drei zum Kürzel addierten Buchstaben entzündet sich augenblicklich die Weigerung von ihm als bundesdeutschem Zuhörer, „CES“ für eine Inklusionstaugliche Art der Behandlung zu halten. Martina Zey gibt ihm Recht mit der Anmerkung, dass Eltern sich der Registrierung ihrer Kinder unter dieser Kategorie in der Regel verweigern. Selten nur bekämen die so eingestuften Kinder auch wirklich Eins-zu-Eins-Unterricht, den das „CES“ doch eigentlich garantieren sollte. „Aussortierung und nicht Inklusion“ wäre das, kritisiert Schulpfarrerin Gunda Wittich aus Duisburg, die auch in Hermannstadt Religion unterrichtet hat (die ADZ berichtete).
Klar, Ohrenpaare aus dem wohlhabenden Westeuropa können so eine raue Handhabung besonderer Bedürfnisse von Schulkindern mit angeborenen Beeinträchtigungen, die das Lernen erschweren, nie und nimmer gutheißen. Von der in Deutschland sehr gängigen Praxis, rasch mit der Aufgabe fertig werdende Kinder anschließend im Klassenraum umhergehen zu lassen, damit sie anderen Kindern helfen, die gleiche Aufgabe ebenfalls zu lösen, ist man in Rumänien weit entfernt.
Inklusion auf dem Papier aber nützt nichts, wenn ihr Umsetzen in der Ausbildung nicht beleuchtet und beigebracht wurde. Niemand unter den Religionslehrerinnen und -Lehrern im Auftrag der EKR hat ein allgemeines Standardrezept für Härtefälle im Klassenraum verfügbar. Hilfslehrer wären ohnehin sehr schwer aufzutreiben in Rumänien, und für Religionsunterricht auf Deutsch leider gar nicht zu finden. „Ich brauche Verständnis, wenn meine Geduld am Ende ist“, sagt Martina Zey. „Manchmal hilft Händchen-Halten“, erzählt Ana-Maria Dimitrescu vom Goethe-Kolleg Bukarest über besonders hartnäckig gestörte Schulkinder, die etwa mit dem Kopf wiederholt an die Tafel schlagen und sich erst bei Halten der Hände beruhigen. Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke ermutigend dazu: „Das ist nicht einfach nur Dienst an der zu inkludierenden Person, sondern auch an der ganzen Klasse.“
Die Sprachfrage
Wobei es weder ein unter dem Kürzel CES geführtes Kind noch das ein oder andere auffällige Störverhalten sein muss, um den Wunsch nach Inklusion zu mäßigen. Franziska Riemer, die in Kronstadt auf Deutsch 15 Klassen Religionsunterricht gibt, kommt um Abstriche in Sachen Sprache nicht herum. „In Rumänien ist der Unterricht in Religion fakultativ, wird aber gewählt, weil er auf Deutsch passiert, nur verstehen es die Schüler in der fünften Klasse oft nicht. Ich habe so eine Klasse, wo die eine Hälfte recht gut und die andere schlecht Deutsch kann. Mehr vermitteln könnte ich in rumänischer Sprache. Eine Lösung für mich ist das Rausgehen in die Kirche, wo dann auf einmal viele Fragen gestellt werden. ´Bin ich eigentlich evangelisch getauft?´, zum Beispiel.“
Ein altersgerechtes Hilfsmittel für das Beibringen seriöser Wörter im Deutschen, die Religion nun mal zwangsläufig mit sich bringt, hat Kirchenmusiker Klaus-Dieter Untch entdeckt, der als Zeichner von „Klaus-Rätseln“ bei Kindern bleibenden Eindruck hinterlässt. Begriffe wie „das Böse“ oder „die Versuchung“ würden sie alle im sehr jungen Alter oft nicht verstehen, doch bei Vergleich mit „răul“ oder „ispita“ ihrer Muttersprache sofort durchschauen. Und „beim Nachspielen biblischer Geschichten mit ganz kleinen Kindern nutze ich auch Plüschtiere als Symbolfiguren“. Vielleicht ist es gerade das, woran eine von seinen Ex-Schülerinnen „in Fogarasch vor 25 bis 30 Jahren“ sich sehr gerne erinnert, die heute ihrerseits evangelischen Religionsunterricht auf Deutsch gibt und am letzten Maitag mit an der Fortbildung teilnimmt.
„Ich unterrichte Physik“, erklärt die vermutlich älteste Dame unter den 22 Erwachsenen, die einander im Bischofshaus der EKR treffen, wiedersehen und kennenlernen. „Aber es ist wichtig für Lehrer von Physik und Chemie, über Gott zu reden“. Eine sinnvolle Fähigkeit, die Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke mit „Offenohrigkeit” bewirbt: „Man soll sie so lange wie möglich breit halten. Ab der dritten oder vierten Klasse geht sie zurück, kann aber im Alter von ungefähr 30 Jahren wieder zurückkommen, wenn sie vor der Verengung einmal dagewesen war.“ Inklusion setzt nicht unbedingt vieles, ganz sicher aber Richtiges voraus. „Für mich ist Religionsunterricht der Sonder-Unterricht. Für Selber-Sprechen, Singen und Sich-als-Gruppe-Sehen für das Verständnis von Demokratie.”, fasst Hans-Georg Junesch in Hermannstadt zusammen.

Leicht einzufordern und schwer umsetzbar – auch evangelisch
Wenn alles passt, treffen in der Schule Religion und Inklusion zusammen
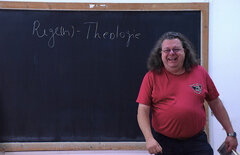
Wäre Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke aus Paderborn nur eine Woche später nach Hermannstadt gereist, würde er vom nassen und kalten Mai nichts mehr gemerkt haben.

Was Schulkinder heute nicht mehr so wie früher gewohnt sind, mögen Religionslehrerinnen und -Lehrer immer noch: einander zuhören.

Günther Cernetzky findet es sehr gut, dass der evangelische Religionsunterricht mehrheitlich von Frauen gestaltet wird – Martina Zey (rechts, mit Brille) und Dr. Angéla Deák (links) horchen auf.

Pfarrerin Angelika Beer (mit vor der Brust zusammengeführten Händen) aus Malmkrog wünscht sich, dass keine Unterschiede mehr gemacht werden. | Fotos: Klaus Philippi




