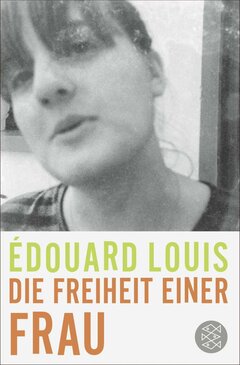Ein kleines Dorf im österreichischen Innergebirg. Ein Dorf mit einer Kirche, einem Gasthaus, einem See und einer Süßwarenfabrik nicht weit, in der die Männer arbeiten. Die Frauen bleiben zu Hause, machen die Hausarbeit. Kochen, putzen, Wäsche waschen, und zwischendurch zum Vergnügen dann auch mal ein bisschen Gartenarbeit. Tag ein, Tag aus dasselbe.
Man hat nicht viel, aber man kennt es nicht anders und macht deshalb nun mal einfach weiter. Bis sich eines Tages – nachdem die Jahrzehnte nur so verstrichen sind – alles ändert: die Fabrik schließt und der Vater verliert seine Arbeit. Aber was dann passiert, hätte sich niemand auch nur im Entferntesten vorstellen können: die Mutter schnappt sich ihr rotes Lederköfferchen, welches sie noch aus ihrer Jugend aufbewahrt hatte, und verlässt das altbekannte Dorf und Leben, einfach so. Sie packt ihre Sachen und geht, um mit über 60 Jahren in Italien bei der Eisenbahn zu arbeiten.
In dieses Dorf, in dem der Vater und die anderen Arbeiter nun arbeitslos sind, und wo die Mutter nicht mehr ist, kehrt die Protagonistin Julia aus Birgit Birnbachers Roman also zurück.
„Wovon wir leben“ (2023, Zsolnay) erzählt von der ursprünglichen Flucht Julias vom Land in die Stadt, wo sie Krankenschwester wurde, vom Schicksal des Vaters und der anderen Männer des Dorfes, für die der Verlust der Arbeit in der Fabrik, die all die Jahre den Alltagsrhythmus bestimmt hatte, den Verlust jeglicher Struktur bedeutet, und von der Flucht der Mutter, die mit viel Überwindung aus ihrem Leben ausbricht. Es ist eine Verstrickung persönlicher Schicksale mit soziologischen Überlegungen zum Verhältnis von Arbeit, Klasse und Gesellschaft; welche Rolle spielt Arbeit in unserem Leben? Oder vielleicht noch eher der Verlust dieser Arbeit? Wie gliedert sich die unbezahlte Care-Arbeit noch heute in unsere Gesellschaft ein? Inwiefern ist der Lebensweg des Einzelnen von seinem sozioökonomischen Milieu geprägt? Kann man diesem je entkommen? Diese und viele weitere Fragen wirft Birgit Birnbacher in ihrer empathischen Erzählung auf, indem sie Frauen eine Stimme gibt, die bisher keine hatten.
Ähnliche Fragen treiben auch Édouard Louis, der aktuell zu den populärsten Intellektuellen und Autoren Frankreichs zählt, umher. In seinen Romanen – die jedoch höchst autobio-grafisch sind – widmet er sich anhand seiner persönlichen Erfahrungen, Überlegungen der Situation der Armut in der französischen Gesellschaft und Öffentlichkeit: die soziale Herkunft, das Entkommen aus dieser und das Verhältnis von Individuen zu gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen des Klassenkampfes sind zentral.
In „Combats et métamorphoses d’une femme“ (2021, Éditions du Seuil), auf Deutsch „Die Freiheit einer Frau“ (2023, S. Fischer), widmet auch er sich einem „Frauenschicksal“, nämlich dem Leben seiner Mutter. Dieses ist ebenfalls geprägt von tradierten Rollenverteilungen und einem ständigen Drang nach Freiheit. Ähnlich wie in Birgit Birnbachers Roman ist dieser Wunsch nach Freiheit ebenfalls mit einem Wunsch zu arbeiten verbunden. Auch gerade, weil ihr dies lange Zeit über von ihrem Mann verwehrt wurde. Schließlich setzt sie sich jedoch durch und Mo-nique – Édouards Mutter – beginnt in den umliegenden Dörfern als Altenpflegerin zu arbeiten. Wieder handelt es sich dabei um eine traditionell weiblich geprägte Beschäftigung, denn Care-Arbeit bleibt nun mal Frauensache. Am Ende der Erzählung entschließt auch diese Protagonistin, ihr Leben hinter sich zu lassen und das Dorf zu verlassen, und damit auch ihre gefestigte Rolle als Mutter und Hausfrau, um nach Paris zu ziehen. Doch kann eine solche Flucht überhaupt gelingen? Vom Dorf in die Stadt, von einem sozialen Milieu in ein so grundlegend verschiedenes?
Eine persönliche Flucht ist nie wirklich zu Ende, die Vergangenheit holt einen immer ein, und die Gewalt der Klassenunterschiede bleibt präsent. Sich angekommen und zugehörig zu fühlen ist schwierig, ja unmöglich?
Auch in Birgit Birnbachers Roman scheint es schließlich eine Kraft zu geben, die das Individuum in sein gewohntes Umfeld zurückholt. Letztlich überwiegt hier die Last des sozialen Milieus und der Geschlechterrollenverteilung, denn Julias Mutter kehrt wider Erwarten – aber doch konform mit gesellschaftlichen Normen – zurück ins Dorf, um den kranken Ehemann zu pflegen. Sie hat zwar kurz ihre Freiheit erlebt, aber letztlich kommt sie zurück ins Haus, an ihren Platz:
„In der Abenddämmerung sieht das Haus friedlich aus. Wir sehen beide, dass sich am Fenster was rührt. Hinter dem halb-durchsichtigen Store taucht eine Gestalt auf, aber auf den ersten Blick erkenne ich, dass das nicht Liliana, sondern Mutter ist. An ihrem Umriss sehe ich, dass ihr Haar wieder in Form geföhnt ist. Eine Weile steht sie nur da, steht hinter dem Store und schaut zu uns heraus oder auch nicht, sieht, dass wir sie sehen, oder auch nicht. Sie legt eine Hand an die Scheibe, aber ich glaube nicht, dass das ein Gruß ist. Eher ist es, als würde sie mir bedeuten, fernzubleiben. So verharren wir eine Weile, sie hinterm Fenster, ich hinter der Scheibe. Bea schnippt die Zigarette zur offenen Tür hinaus, schaut mich erwartungsvoll an. Ich bedanke mich bei ihr fürs Fahren, umarme sie und sage, dass ich sie morgen anrufe. „Ich kann dich rausbringen“, sagt sie. „Ich danke dir“, sage ich, verabschiede mich und steige aus. Als ich die Autotür zuschlage, zupft Mutter den Store zurecht und zieht die Vorhänge zu.“ (S. 188-189)
In „Wovon wir leben“ spielt die Arbeit also eine zukunftsweisende und -entscheidende Rolle, sowohl für den Vater und für die Mutter als auch für die Protagonistin Julia selbst. Besonders der Verlust dieser Arbeit zieht jedoch ein noch größeres Beben nach sich, und mit der plötzlichen Care-Arbeit, die der Vater braucht, fügt sich dem Stellenwert von Arbeit noch eine weitere Bedeutungsschicht hinzu.
Dahingegen ist für Monique in „Die Freiheit einer Frau“ die Arbeit eher Vehikel ihrer Flucht aus ihrer sozialen Klasse und ihren prädestinierten Rollen als Hausfrau und Mutter. Gleichzeitig ist die Thematik der Arbeit in Louis‘ Erzählung zwar allgegenwärtig, jedoch spielen die Beziehung Moniques zu ihrer Familie oder die generellen Lebensumstände der armen Bevölkerung Frankreichs eine mindestens genauso ausschlaggebende Rolle für ihr persönliches Schicksal. Arbeit kann also in beiden Fällen durchaus befreiend wirken, sie macht die sozialen Hintergründe und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eines Menschen aber nicht unwirksam.
Die beiden literarischen Werke zeigen auf komplementäre Art und Weise, wie schwer – ja für Julias Mutter letztlich unmöglich – es ist, aus gesellschaftlichen Rollen und Klassen auszubrechen. Mit all den geschlechterspezifischen Ansprüchen und der noch immer weiblich geprägten Care-Arbeit scheint dies besonders als Frau geradezu unmöglich, da anerzogene Denkweisen stets versuchen, das Individuum zurück in seine designierte Rolle zu holen. Birgit Birnbacher und Édouard Louis laden aber beide dazu ein, diese Umstände des persönlichen Schicksals in einer größeren Perspektive – im Verhältnis von Arbeit und sozialer Klasse – zu hinterfragen.