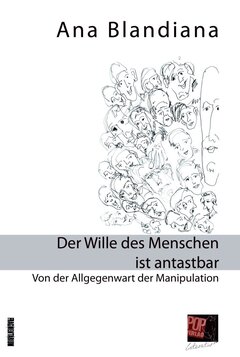Bereits seit den 1960er Jahren zählen Ana Blandianas Gedichte zu den auffälligsten, gedankenreichsten und wirkungsvollsten in der zeitgenössischen rumänischen Literatur. Auch als namhafte Intellektuelle ist sie keine Unbekannte. Daher stellen sich eingehende Fragen nach ihrer geistig-moralischen Haltung, ihrem intellektuellen Standort und ihrem Einfluss auf die rumänische Öffentlichkeit im Laufe ihrer langjährigen Tätigkeit, die unter wechselvollen politischen und kulturellen Zeitumständen erfolgte. Zu solchen Fragen vermag der vorliegende, 632 Seiten umfassende Band in vorzüglicher Weise Antworten zu geben.
Bereits am Anfang bekundet Ana Blandiana zur Bedeutung der Literatur und des Schreibens in ihrem Leben wie auch den Anliegen, die sich damit verbinden: „Aufgezeichnet habe ich nie etwas anderes als Gedanken; Tatsachen erschienen mir stets unwichtig und mein eigener Werdegang von Interesse nur nach Maßgabe der Seiten, die ich, indem ich sie schrieb, vor dem Nichts zu retten vermochte. (…) Subjekt der Erkundung bin selbstverständlich ich selbst, wichtig erscheint mir jedoch, dass es sich nicht lediglich um eine Fallstudie handelt, dass verstörender als die Beispiele, als die Antworten auf die Frage (wer wen manipuliert, wer es schafft und wer nicht, zu manipulieren oder sich nicht manipulieren zu lassen) die Wahrheit ist, dass im Mittelpunkt aller Kräfte, Dinge, Tatsachen, Begebenheiten, Personen (…) der Wunsch zu manipulieren steht.“ (S. 13). Wenn im Titel des Buches, der „Wille des Menschen“ als „antastbar“, als ungeschützt, als beeinflussbar und durch allgegenwärtige „Manipulation“ und Zersetzung bedroht angesehen wird, so steht virtuell doch etwas anderes im Zentrum des Existenzverständnisses Ana Blandianas: nämlich die zwar stets gefährdete und bedrohte, aber gerade deshalb entschieden schützenswerte Würde des Menschen. Deren durch das Schreiben und durch Aufklärung zu verteidigender Kern ist die Wahrheit. Deren Grundwert die Freiheit. Deren häufig einzige Verwirklichungsbedingung die Einsamkeit, der Rückzug, die Weltflucht. Die Freiheit des menschlichen Willens wird von ihr allerdings ganz im Sinne der idealistischen Philosophie zugleich unabdingbar verbunden an Grundsätze der elementaren Sittlichkeit verstanden.
Das „Böse“ und der Kommunismus
Für Ana Blandiana hat diese Moral und Sittlichkeit eine eindeutige Richtschnur, eine geradlinige und zweifelsfreie Orientierung und Verortung zwischen „Gut und Böse“ im christlich-religiösen Sinne wie auch im Koordinatensystem historisch-politischer Herrschaftsgegebenheiten. Wobei das politisch erlebte „Böse“ für sie vor allem den verschiedenen Erscheinungsformen des Kommunismus, seiner Geheimdienste und Spitzelsysteme, seiner Repression, seiner Verfolgungs- und Zersetzungsmethoden, seiner Verbrechen, entsprach. Diese Sicht wiederum hat vielfältige autobiografische Hintergründe, erlebte sie doch bereits in ihrer frühen Kindheit, in der stalinistischen Zeit, wie ihr Vater, ein orthodoxer Pfarrer, vor ihren Augen verhaftet wurde und anschließend als politischer Häftling Jahre in kommunistischen Gefängnissen verbrachte. Die zusammen mit ihrem 2016 verstorbenen Ehemann Romulus Rusan gegründete Gedenkstätte „Memorial Sighet“ für die Opfer der Kommunismus und des antikommunistischen Widerstands in Rumänien ist sicherlich nicht zuletzt vor diesem persönlichen Erfahrungshintergrund zu sehen und zu verstehen.
Aber auch darüber hinaus gilt aus ihrer Sicht: „Im Grunde ist die Geschichte der Menschheit gar nichts anderes als die ständige Anstrengung, das Gute vom Bösen zu scheiden, ihre großen Persönlichkeiten sind gekennzeichnet durch die Art und Weise, in der sie sich im Rahmen der Freiheit entschieden haben, die ihnen die Macht verliehen hat und die sie den anderen eingeräumt haben oder nicht.“ (S. 65f) Dabei gibt sie gleichzeitig zu bedenken: „Denn ich bin seit eh und je überzeugt, dass Sokrates recht hatte, als er sagte, unglücklicher als der, dem ein Unglück widerfährt, sei nur der, der es verursacht hat.“ (S. 27). Ob durch die Geschichte der Menschheit tatsächlich ein solches Prinzip höherer göttlicher Gerechtigkeit waltet, wäre näher zu prüfen. Dieser Gedanke ist es jedenfalls wert, genauer erörtert zu werden.
Das manipulative und korrumpierende „Böse“ erscheint allerdings keines-wegs auf den historischen Macht-, Wirkungs- und Erfahrungshorizont des Kommunismus oder totalitärer Herrschaftssysteme begrenzt: „Die Machthaber setzen es heutzutage nicht dazu ein, ihre Gegner zu quälen, ja sie wählen ihre Opfer gar nicht unter den Gegnern aus. Ihre Opfer sind, schlicht und einfach, die anderen, die nicht lügen, sich nicht arrangieren, sich nicht durchschlagen können - wie sie“. (S. 29). Gleichwohl ist es auch in der postkommunistischen Zeit nicht unmöglich, Kriterien und Maßstäbe der distinktiven Wahl, wie etwa bei anstehenden demokratischen Präsidentschaftswahlen, zu finden: „Es sei eines, einem einstigen Parteifunktionär zu glauben, der lügen, schmeicheln, falsche Berichte über Hektarerträge hat abgeben müssen und jetzt im Namen eines Gedankengutes kandidierte, das er früher abgelehnt hat, ein anderes aber sei es, einem ehemaligen Polithäftling Vertrauen zu schenken, der es vorgezogen hat, im Gefängnis zu sitzen, statt seine Gedanken zu widerrufen.“ (S. 97 f).
Messlatte: bewährte moralische Kriterien
Für Ana Blandiana sind es der Charakter, der „Anstand“ und die „Fähigkeiten“ der Menschen und nicht zuletzt das in der Vergangenheit gezeigte und bewährte Handeln, das wichtige Akteure in schwierigen historischen Schlüsselsituationen tauglich oder unfähig macht, wenn es um maßgebliche und Weichen stellende Entscheidungen für die Gegenwart und Zukunft geht: „Dass sich die Utopien, von der Französischen bis zur Russischen Revolution, als kriminell herausgestellt haben, ist weder ein Argument dafür, dass die Welt nicht verändert werden muss, noch eines dafür, dass sie gut ist, wie sie ist, sondern nur eines dafür, dass alles an den Fähigkeiten derer liegt, die dazu in der Lage sind. Wesentlich wäre die Frage, ob die Anständigen stets unterlegen und die Empörten stets gewalttätig sind und ob es schicksalhaft ist, dass sich die Gewalt in letzter Instanz stets der Kontrolle der Wohlmeinenden entzieht.“ (S. 119).
Zu der hervorragenden Bedeutung einzelner Menschen als „Vorbilder“ und Weichensteller historischer Entwicklungen merkt sie an: „Wahrhaft von Nutzen in der Geschichte (ganz gleich, welcher Geschichte) sind am Ende einzig und allein die Vorbilder. Gibt es sie nicht, so nützen Ideen, ja selbst Taten nichts, sondern sie vergehen, ohne Spuren zu hinterlassen, als wären all die Anstrengungen, die zu ihnen geführt haben, gar nicht oder umsonst unternommen worden.“ (S. 225).
Wie die Machtausübung, die Intrigen, Manipulationen und Zersetzungsmethoden des kommunistischen Herrschaftssystems und die Machtkonflikte in der postkommunistischen Zeit und politischen Arena wichtige Gegenstände ihrer scharfsinnigen, an intakten moralischen Maßstäben gemessenen, manchmal vielleicht auch etwas weltfremd oder naiv wirkenden Kritik sind, so tritt Ana Blandiana auch als ebenso gründliche Beobachterin des rumänischen Literaturbetriebes zu verschiedenen Zeiten in Erscheinung. In ihrer Zusammenschau begegnen wir hierbei teils beschämenden, teils ernüchternden, teils aber auch eindrucksvollen und ermutigenden Zeugnissen des rumänischen Geisteslebens und Literaturgeschehens unter kommunistischer Herrschaft und darüber hinaus.
Blandiana, die nichtpolitische Politikerin
Ana Blandiana versteht das Schreiben und die Literatur als wichtigste Ausdrucksform ihres eigenen Existenzverständnisses und ihrer Lebensweise. Daher liegt nahe, dass sie historischen Größen der nationalen rumänischen Literatur wie Mihai Eminescu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Lucian Blaga u.a. innig zugeneigt erscheint und diese Art der Wertschätzung ganz selbstverständlich auch dem in diesem Sinne besten Teil der rumänischen Kultur entgegenbringt. Neben der hervorragenden Kulturbedeutung, die sie der wertvollen Literatur zuschreibt, gilt ihre Wertschätzung und Sympathie, wie sich an vielen Stellen des Buches nachlesen lässt, gleichermaßen dem einfachen, häufig unterdrückten und nicht selten auch verachteten rumänischen Volk und insbesondere der Bauernschaft, etwa in ihrem „Widerstand gegen die Kollektivierung“. (S. 91f).
Diese echte Wertschätzung und Liebe zum gleichsam idealisierten rumänischen Volk oder seines besten Teils kontrastiert indes vielfach mit dem nüchternen, realistischen und kritischen Blick, der seinem unerträglichen „Hass“, seiner „Zerrissenheit“ und anderen postkommunistischen Erscheinungsformen gilt (S. 437). Sicher ebenso schwer wiegt der Vorwurf: „Die Rumänen münzen ihre Minderwertigkeitskomplexe zu Überlegenheitskomplexen um, die sich in einem Hohn äußern, der all das zersetzt, was sie nicht verstehen.“ (S. 344).
Was Ana Blandianas Verhältnis zur „Heimat“ betrifft, so sind dazu vielleicht ihre Erfahrungen und Reflexionen zu Rumänen im „Exil“ die aufschlussreichsten. Nicht nur, dass für sie persönlich, wie sie mehrfach erwähnt, nie in Frage kam, im Ausland zu bleiben. Am Beispiel berühmter Rumänen im Exil wie Emil Cioran, Eugen Ionesco oder Mircea Eliade, denen sie bereits früh, als junge Dichterin, in Paris oder in den USA begegnete, zeigt sie sehr gut das Dilemma und das Leiden an der verlorenen Heimat auf. (S. 552ff).
Zum Schluss noch eine kurze Anmerkung zu Ana Blandianas politischer Haltung, zu ihrem politischen Wirken. Möglicherweise sind diese mit dem auf den ersten Blick paradox klingenden tschechischen Konzept der „nichtpolitischen Politik“ („nepolitická politika“) am trefflichsten charakterisiert, das auf Dissidenten der 1970er und 1980er Jahre wie den Schriftsteller Václav Havel oder den Philosophen Jan Sokol bezogen wurde, dessen Tradition in der tschechischen Ideengeschichte aber bis Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht, wie der Sozialwissenschaftler Dirk M. Dalberg darlegte. Nichtpolitische Politik ist eine konsequente intellektuell-moralische Haltung, die sich ganz bewusst und entschieden kritisch von der alltäglichen Politik, von ihren Intrigen, Manipulationen, ihrer De-magogie, ihren ideologischen Phrasen und Plattitüden, ihrem Parteiengehabe, ihren faulen Kompromissen usw. distanziert und persönlich fernhält. Sie setzt stattdessen auf unbedingte moralische Integrität, intellektuelle Aufklärungs- und Überzeugungskraft. Nichtpolitische Politik und ihre nicht selten charismatischen Vertreter bilden gerade in außeralltäglichen historischen Umbruchzeiten notwendige Alternativen, Visionen, „Vorbilder“, Auswege, selbst wenn bald danach wieder der gewöhnliche politische Betrieb dominiert.
Diese wenigen Facetten anregender Überlegungen zu ausgewählten Aspekten sollten bereits zu erkennen geben, dass es sich um ein lesenswertes Buch handelt, dem man möglichst viele Leser wünscht. Die vorliegende Übersetzung des Bandes durch den aus Siebenbürgen stammenden Schriftsteller, Literaten und vielfach bewährten Dolmetscher und Übersetzer Georg Aescht ist in einer gediegenen, reflektierten, von einer gründlichen Sachkenntnis geleiteten, ernsten, gera-dezu vornehmen und allemal treffsicheren Sprache gehalten, die das Buch verständlich und ansprechend lesbar macht. Der Qualität der Übersetzung steht das „Geleitwort“ des Übersetzers nicht nach, das kenntnisreich und passend in das Werk einführt.