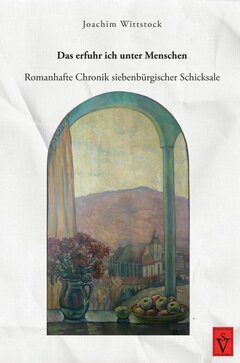Wie sich die Welt für Eingeschlossene anfühlt, beschäftigte Jean-Paul Sartre. Der französische Autor und Philosoph kam zu dem Schluss, dass die Freiheit des Menschen trotz widriger Umstände unbeschadet bleibt: Die Freiheit ist der Existenz innewohnend – und dadurch unveräußerlich. Freiheit ist ein kosmisches Geschenk, das sich allerdings im Anbetracht der großen Verantwortung, die mit ihr einhergeht, oft als Bürde, ja sogar als Verurteilung ausnehmen kann. – Diese Erfahrung leuchtet ein, liest man Joachim Wittstocks jüngst erschienenes Buch mit dem orakelhaften Titel „Das erfuhr ich unter Menschen“: Um das Eingeschlossensein in seiner beängstigendsten Aufmachung geht es dem siebenbürgisch-sächsischen Autor, der in seiner „Romanhaften Chronik siebenbürgischer Schicksale“ zum Investigativjournalisten mutiert und die Geschichte eines Gebäudes wie einen Detektivroman entrollt. Im Fokus steht dabei eine kleine Minderheit, die große Weltbrände erlebt.
Titelgebend für das Buch des 1939 in Hermannstadt/Sibiu geborenen Schriftstellers, Dichters und Essayisten ist ein Vers des um das Jahr 800 aufgezeichneten „Wessobrunner Gebetes“. Vom althochdeutschen Schöpfungsgedicht scheint der Autor meilenweit entfernt zu sein – und dennoch verbindet ihn ein zartes Band mit all jenen, die vor vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten über die Existenz nachgedacht haben. Wie merkwürdig ein Menschenleben doch sein kann? Wie bricht unversehens in eine vertraute Umgebung das Unentschlüsselbare ein und macht sie einem fremd! Der einzelne Mensch kann gewaltigen gesellschaftspolitischen Umbrüchen oft nichts entgegensetzen und steht mit leeren Händen da. Trotz vieler Fragezeichen will er überleben. Die Fragen können warten, sie können später – von den Nachfolgern - beantwortet werden. Und ein solch fragender Nachfolger und Nachforscher ist Wittstocks Ich-Erzähler. Wir erfahren nicht nur, was vielen siebenbürgischen Familien widerfuhr: Wir werden aufgefordert, Zusammenhängen bis in die Jetztzeit nachzuspüren.
Wie kann es sein, dass sich ein Arzt, der in seinem Tun und Lassen stets das Heil der Menschen verfolgt, in eine Situation gerät, die ihm entgleitet? Obwohl er so vieles durchdringt, sogar ein Medikament gegen Krebs entwickelt, wird er dem Schicksal eines Eingeschlossenen nicht entgehen können. Absurd ist die Situation in der „Schlüsselpunkt“ betitelten Geschichte in Wittstocks „Chronik“. Doch kann eine Vergangenheitsbewältigung genau hier, an so einem „Schlüsselpunkt“, ihren Anfang nehmen und ein historisches Geflecht entwirren. Das Netz der Chronik ist fein gewebt – und es bietet Einblick in außergewöhnliche Familiengeschichten, die allesamt in irgendeiner Weise mit der Historie eines Gebäudes und einer ethnischen Gruppe, den Siebenbürger Sachsen, verbunden sind.
Totalitär waren die Regime, die aus dem 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart überschwappen. Totalitär, weil unwiderruflich, können allerdings auch Entscheidungen anmuten, die beispielweise ein historisches Gebäude zweckentfremden. Gebäude sind – wie Menschen – vom Eingeschlossensein betroffen und den Zeitläuften ausgeliefert. Doch, findet sich ein Chronist wie Joachim Wittstock, der sich „treu, wahrhaft, geduldig“ ans Werk macht, gerät weder Gemäuer noch Mensch in Vergessenheit. Im gegebenen Fall handelt es sich um eine von Dr. Wilhelm Depner (1873–1950) gegründete Klinik in Kronstadt/Bra{ov. Ihm und seiner Tochter Dr. Thea Wittstock, geb. Depner (1911–1985), ebenfalls Medizinerin und Ärztin im einstigen Krankenhaus ihres Vaters, ist Wittstocks Buch gewidmet. Trotz der sich verfinsternden Zeit, der anbrechenden kommunistischen Ära, schloss sich Thea den Idealen ihres Vaters an. Letzterer hatte in seiner 1929 in Kronstadt gehaltenen Rede zum Auftakt des „Ärztlichen Hochschulkurses“ hervorgehoben: „Wenn es besser werden soll, so müssen wir zurück zu den alten Idealen unseres hohen Berufs, wie sie vor mehr als zwei Jahrtausenden der größte Arzt aller Zeiten, Hippokrates, gelehrt hat“ – Thea gaben diese Worte Orientierung so wie das „Wessobrunner Gebet“ und eine Grabinschrift auf dem Hermannstädter Zentralfriedhof dem Chronisten Wittstock durch alle Irrungen und Wirrungen des vergangenen Jahrhunderts ein sicheres Geleit gewähren. „Die verstreichende Zeit fremdet uns ab.“ Wittstocks Wortneuschöpfung „abfremden“ zeigt an, was dieser Prozess bewirkt: Er bringt uns die Geschehnisse näher – so nah, dass sich uns Zusammenhänge erschließen und wir die Eingeschlossenen besser verstehen.
Da sich auf den 650 Seiten der Chronik unzählige Personen tummeln, ist es äußerst hilfreich, dass der Autor die wichtigsten Akteure mit ihren familiären Bezügen auf zwei Seiten vorab auflistet. Aus der Fülle der Lebensgeschichten sticht das Schicksal von zwei gegensätzlich angelegten Charakteren – Samuel Tartler und Volkmar Decani – beson-ders hervor.
Sanatoriumsgründer und -leiter Dr. Samuel Tartler lebt mit seiner Ehefrau und drei Kindern in Kronstadt. Er ist ein verantwortungsbewusster Chirurg. Es heißt, seine Hand „habe sowohl energisch zupacken können als auch über die zu operativem Schnitt und zur Wundnaht erforderliche Schmiegsamkeit verfügt“. Er wird als integrer Mensch beschrieben. Gegenüber den von der NS-Ideologie infizierten siebenbürgisch-sächsischen Hitzköpfen zeigt er Haltung und grenzt sich entschieden ab. Das völkische Denken ist ihm fremd: In seinem Sanatorium macht er keinen Unterschied zwischen sächsischen, rumänischen, ungarischen und jüdischen Patienten, was ihm nach dem Zweiten Weltkrieg der Oberrabbiner der Kronstädter jüdischen Gemeinde hoch anrechnen wird. Als Vertreter des Deutsch-Sächsischen Volksrates und „als Traditionalist“ zählt er zum „alten Eisen“. Da er sogar den Hitler-Gruß verweigert, wird er von den deutschen Patrioten Siebenbürgens angefeindet.
Samuel Tartler ist auch ein „Familienmensch“, der sich an den Erfolgen seiner „kunstsinnigen Frau“ Mathilde und seiner Kinder erfreut. Seine älteste Tochter Dorothea wird später in seine Fußstapfen treten und in der nächstfolgenden Diktatur – der kommunistischen – ebenso Haltung zeigen wie er in der NS-Zeit. Seine Frau Mathilde ist weit über die Grenzen Siebenbürgens hinaus als Künstlerin bekannt – vor allem durch ihr Werk „Die Sinkende“, eine Skulptur, die „Bombennächte“ und „Tagesbrände“ übersteht, bevor sie schließlich im Stuttgarter Kunstmuseum landet. Gegen Ende seiner Chronik erinnert sich der Ich-Erzähler anlässlich einer Geburtstagsfeier an Mathilde: Als ihre Enkelin Constanze Decani, eine in Rente gegangene Journalistin, von Bukarest in ihre Heimatstadt Kronstadt zurückgekehrt, zu ihrem runden Geburtstag im Jahr 2020 einlädt, trifft der Ich-Erzähler an der Festtafel all jene, die bereitwillig zum Tartlerschen Sanatorium Auskunft geben. Für die Chronik hält er fest: „Als sie (Constanze) „die Honneurs“ machte, wurde ich an ihre Mutter in ähnlichen Szenen erinnert, mehr noch an ihre Großmutter, Mathilde Tartler, welche dergleichen gesellschaftliches Zeremoniell überaus wichtig nahm, und das umso mehr, als es ihrer Natur entsprach, in dieser stets auf stimmige Choreographie gerichteten Art aufzutreten.“
Am Tisch der Jubilarin sitzt auch ihr Bruder Ortwin Decani, der ebenfalls zur Erbengemeinschaft des Dr. Tartlers gehört und bemüht ist, die „Angelegenheit“ des einstigen Sanatoriums einem „guten Abschluss“ zuzuführen. Die Chronik wird den „21. Januar 2021“ als „Schlussstrich“ bezeichnen – der Verkauf des Gebäudes steht an, aus dem einstigen Sanatorium soll ein Hotel (und zum Glück kein Parkhaus) werden: „Das Anwesen tritt hiermit in eine Etappe, die die Erinnerung noch weiter abtreiben wird vom Gegenwartsgeschehen.“ Und der Chronist? Er fügt sich in die Gegebenheiten der Jetztzeit und sinniert: „Sollte es mir vergönnt sein, das zu erleben, will ich bei einem künftigen Kronstadt-Aufenthalt dort vorstellig werden und fragen: ‚Können Sie mich unterbringen, kann ich bei Ihnen einkehren??“
Während sich Samuel Tartler wie ein Fels in der Brandung ausnimmt, ist sein Pendant, Volkmar Decani, ein wankelmütiger Charakter – beruflich und privat ist er wie „vom Winde verweht“. Mit Kronstadt verbunden ist auch diese schillernde Gestalt: „Berufliche Ansätze wie auch familiäres Geflecht hatten ihn in Kronstadt zu Bindungen politischer, wirtschaftlicher oder rein menschlicher Natur geführt.“ Als einer von jenen, die zeitlebens „der Welt von Wein-Weib-Gesang verhaftet“ sind, wird sein „Vermächtnis“, trotz dreier Ehefrauen und dreier Töchter, bescheiden ausfallen. Und beruflich? „Herr Volkmar“ ist zum Schluss seiner Laufbahn „literarischer Translator“, doch einst war er stolzer k. u. k. Hauptmann, dann rumänischer Offizier, in der Zwischenkriegszeit bei einer Firma zur Erdölgewinnung und während des Zweiten Weltkriegs als „rühriger Publizist“ tätig. Als Presseagent wird er von dem in Bukarest stationierten deutschen Kulturattaché Dr. Rundlich, trotz „kriegerischer Wirrnis“, auf „Kundfahrten ins Hinterland“, nach Bessarabien und Transnistrien, entsandt. Er kundschaftet Flusshäfen aus: Tiraspol am Dnejstr, Cherson am Dnepr und Nikolajew am Bug – „sehenswerte Städte, trotz Achtlosigkeiten und Schäden, die das Weiterrücken der Ostfront mit sich gebracht hatte“. Es ist der Höhepunkt der Absurdität, diese mitten im deutschen Angriffskrieg gegen die Sowjetunion stattfindenden Expeditionen als „gründliche gesellschaftlich-kulturelle Ermittlungen“ zu verbuchen und den Gerbermeister Bogner, einen von den vielen Trägern dieses Namens, in Odessa ausfindig machen zu wollen. Statt Bogner wird „Herr Volkmar“ auf das Mütterchen Swetlana Iwanowna treffen – mit verhärteten Gesichtszügen holt sie ihn in die Realität zurück: Die Zerstörungen durch das deutsche Militär sind allgegenwärtig. Sie sind es bis heute – nur das Militär ist ein anderes. Und schon wieder stehen die Menschen aus jener gebeutelten Gegend, die Timothy Snyder „Blood-lands“ nennt, vor dem Nichts und die „Decaniaden“ von skrupellos agierenden Menschen gehen weiter. Fazit: Ein Roman kann sich erschreckenderweise wie eine Chronik ausnehmen.
Wer sich zu Beginn gefragt hat, was das alles mit Sartre zu tun haben soll, der sei zum Schluss an dessen Frage erinnert: „Was hast du aus deinem Leben gemacht?“ Die Frage, die der Existentialist an „Die Eingeschlossenen“ richtet, schwingt als stiller Imperativ in Wittstocks „romanhafter Chronik“ mit.
Ende April kam das neue Buch „Das erfuhr ich unter Menschen“, eine romanhafte Chronik, von Joachim Wittstock heraus, das er bei den Deutschen Literaturtagen am 29. April in Reschitza vorstellte. Berichtet wird darin von einem Sanatorium in Kronstadt und von der wechselnden Bestimmung des Gebäudes, von seinem Ausbau und der mehrfachen Zweckentfremdung. Klinisches kommt zur Sprache, doch auch reichlich von dem gesellschaftlichen und politischen Geschehen um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Und das anhand von Lebensläufen, die von den Zeitereignissen zurechtgeformt wurden.
Auf die Frage, warum er den „chronikalischen Realismus” benutzte, antwortete er in einem Interview in der Siebenbürgischen Zeitung (19. Juni 2024): „Will man literarische Phantastereien vermeiden, falsche Gewichtungen in der Komposition und Einzelepisode, will man albernen Verzerrungen und gewagten Erfindungen aus dem Weg gehen – wie man sie aus der Lektüre kennt und auch im Rückblick auf eigene Missgriffe beklagt –, tut man gut, sich auf die Schilderung von tatsächlich Geschehenem einzustellen sowie aufs Porträtieren von Personen, denen man begegnet ist oder die man hat treffen können.“