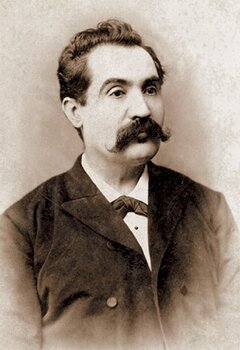Fortsetzung vom vergangenen Freitag, 27. Juni
Aus den Unterlagen, die Dr. Ion Gr²mad² von einem Sanatoriums-Assistenten über den Aufenthalt Eminescus im Sanatorium zur Verfügung gestellt, geht hervor, dass die Krankenakte von P.P. Carp von einem Vertreter der Rumänischen Botschaft in Wien in Empfang genommen wurde.
Schöpferische Leistung nicht beeinträchtigt
Dr. Obesteiner schrieb über Eminescus Sanatoriums- Aufenthalt: „12 Jänner. Von der Isolierabteilung weg. Singt nicht mehr, eher deprimiert, gibt nicht mehr die falschen Namen, liest. Besuch Maiorescu’s ohne nachhaltigen Einfluss.
24 Jänner. Anscheinend recht gut, gibt über alles passende Antwort, erinnert sich nicht an den Beginn seiner Krankheit, teilnehmend, ernst, freut sich, wünscht Auskunft über seine Verhältnisse.
8 Februar. Recht gut, aber ziemlich verschlossen, kümmert sich sehr viel um das Essen, kann sich nicht recht beschäftigen, liest wenig.
26 Februar. Reist mit Herrn Chibici nach Florenz. Dauer des hiesigen Aufenthaltes: 2 November 1883 – 26. Februar 1884.”
Der Forscher Constantin Barbu (*1954), Mitglied der Europäischen Akademie (Academia Europensis), präsentierte einen Brief, in dem Titu Maiorescu Eminescus Krankengeschichte änderte und Syphilis hinzufügte.
Weitere Studien weisen darauf hin, dass Eminescu kleinlichst von Titu Maiorescu missbraucht wurde, der sich von den Schöpfungen des Dichters Vorteile versprach.
Es war auch Constantin Barbu, der sowohl Titu Maiorescu als auch Ecaterina (Szöke) Slavici als Agenten der Doppelmonarchie einstufte.
Constantin Barbu erinnert auch an eine 1972 von Dr. Ion Nica veröffentlichte Arbeit „Mihai Eminescu, psycho-somatische Struktur“ (Mihai Eminescu. Structura somato-psihică).
Auch hält Constantin Barbu weiterhin fest, dass Eminescu nicht an Syphilis erkrankt war. Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Dichter Narben an den Beinen aufwies und vergrößerte Nieren hatte.
Es ist ein zutreffendes Merkmal, das den wahren Grund der Todesursache des Dichters festhält.
Dr. Ovidiu Vuia (*18. März 1929, Arad – † 29. September 2002, Gießen), Facharzt für Neuropathologie – hält in einem Fragment „Über das Leiden und den Tode Mihai Eminescus“ schlussfolgernd fest:
1. Aufgrund meines pathographischen Studiums, gestützt auf Unterlagen und dokumentarisch belegt sowie deren hermeneutischen Deutungen, also ohne Berücksichtigung anderer, externer (äußerlichen) nichtwissenschaftlicher Umstände, geht eindeutig hervor, dass Mihai Eminescu einer wahnsinnigen depressiven Psychose ohne anatomisches Substrat – auch endogen genannt –, erkrankt war. (Pathographie – auch Pathografie bezieht sich auf die Darstellung und Erforschung von körperlichen und seelischen Anomalien und Krankheiten bedeutender Persönlichkeiten sowie die Untersuchung der Auswirkungen dieser Krankheiten auf das geistige Werk. Vgl. Wikipedia: Pathographie)
Der Dichter hatte also weder eine Lues-Erkrankung, noch eine allgemeine progressive Paralyse oder eine andere Form der Erkrankung in dieser Richtung.
2. Zwischen 1883-1889 war keine sogenannte „Große Umnachtung“ feststellbar, die psychische Erkrankung hat seine schöpferische Leistung nicht beeinträchtigt und er erfreute sich einer klaren Denkweise eines normalen Gehirns. Es bestand keine wissenschaftlich erklärbare Grundlage in seinem dichterischen Schaffen während des Leidens, die auf eine mechanische Wiederholung aus dem Gedächtnis der von vor 1883 geschriebenen Versen hinweist.
Gedichte wie „De ce nu-mi vii“, „Kamadeva“, „La Steaua“, sowie 55 weitere Gedichte wie „Dalila“, die während seiner Krankheit entstanden sind und die zu den bei Titu Maiorescu befindlichen Handschriften gehören bzw. posthum erschienen sind, wie „Scrisoare a V-a“, sind Beweise für seine anhaltende schöpferische Tätigkeit auch während seiner Krankheit.
Zu erwähnen wären auch seine sehr guten Übersetzungen wie z.B. anscheinend eine Skizze von Mark Twain sowie das Theaterstück „Laïs“ von Émil Augier, eine antike Ein-Akt-Komödie in Versform, datiert 1888.
Von einer „Großen Umnachtung” kann also während seiner Krankheit keine Rede sein, zumal das auch andere Forscher bezweifeln.
(Endogen bedeutet, dass etwas aus inneren Ursachen entsteht oder aus dem Inneren eines Systems heraus nach innen oder außen wirkt. Das Gegenteil ist exogen. Diese Worte finden in verschiedenen Wissenschaften Verwendung).
So wird angenommen, dass die Kenntnisse im Bereich des Sanskrit in der Zeit 1884-1886 das Niveau eines Spezialisten erreicht hätten, dass jedoch jene vor dem Ausbruch der Krankheit lediglich als die eines Laien festgestellt werden konnten.
Außerdem haben die bedeutenden Mathematiker Octav Onicescu (1892-1983) und Aurel Avramescu (1903, Radna – 1983), die Eminescus während seiner Krankheit entstandenen Schöpfungen untersucht haben, festgestellt, dass einige Werke im Februar/März 1889 entstanden sind, was auf mathematische Kenntnisse des Dichters schließen lässt, Rechnungen, die ein Geisteskranker nie hätte durchführen können.
Darüber hinaus sei auch der Beitrag von Al. Oprea (1931 – 1983) über den Wissenschaftler Eminescu zu erwähnen sowie die klare Korrespondenz des Dichters während seiner Krankheit.
Aufgrund dieser Studien und Erkenntnisse kann festgehalten werden, dass Eminescu zur Zeit seiner Einweisung in die Klinik lediglich an manischen Depressionen psychischer Natur erkrankt war sowie keine anderen Symptome aufwies, Umstände, die eine mögliche generelle progressive Paralyse ausschließen.
Anzeichen einer Quecksilber-Vergiftung
Eminescu beklagte sich bei Gheorghe Bojeicu, einem einstigen Schulkollegen aus Czernowitz, dass er im November 1886 ins Krankenhaus des Klosters Neam] als Verrückter eingeliefert wurde, wo er bis April 1887 ausharren musste und dort mit kaltem Wasser überschüttet und mit einem nassen Seil – zwecks Beruhigung – geschlagen wurde.
Im Krankenhaus macht sich im April/Mai 1887 beim Patienten ein zunehmdes Zittern der Gliedmaßen, der Zunge und des Mundes, eine Ataxie bemerkbar, begleitet von einem leichten Delirium mit allerdings lichten/klaren Phasen, so wie diese auch von Besuchern festgehalten wurde.
Der Dichter war in Boto{ani während seiner Behandlungen mit Quecksilber sehr betroffen, weil diese Behandlungen bedrohende Vergiftungserscheinungen mit all ihren Folgen ausgelöst hatten. Doch weder Dr. Iszak noch die Ärzte in Jassy, die diese falsche Behandlung angeordnet hatten, können für Eminescus Ableben belastet werden, denn sie erkannten die ersten Anzeichen einer Vergiftung und haben die Behanldlung sofort ausgesetzt.
Eminescu litt weder an Syphilis noch war er Alkoholiker; er war an einer manisch-depressiven endogenen Psychose ohne organisches Substrat erkrankt; dadurch wurde seine intelektuell-schöpferische Schaffenskraft keinesfalls beeinträchtigt.
Eine sogenannte „Große Umnachtung“ wie von einigen Eminescu-Forschern der Zwischenkriegszeit angenommen wurde, hatte nicht bestanden.
Sein Ende wurde durch eine Herzsynkope (kardiale Synkope), hervorgerufen von der Quecksilberbehandlung, die dem Dichter während seines Sanatoriumsaufenthaltes im Februar-Juni 1889 in Bukarest von Dr. Șuțu verabreicht worden war.
Quecksilber, Morphium, Arsen
Nicolae Georgescu äußert den Verdacht, dass die seelische Krankheit des Dichters bloß eine Inszenierung seiner Gegner, angeführt von der Freimaurerei, wäre und unterstellt dieser gar die Ermordung des Dichters, Variante, die laut Pamfil [eicaru (18.4.1894–21.10.1980), einem ausgezeichneten Kenner der sozial-politischen Gegebenheiten im Rumänien der Zwischenkriegszeit, von den Politikern dieser Zeit nicht ernst genommen wurde. In diesem Zusammenhang gäbe es keinerlei Indizien oder gar Beweise, die diese Annahmen unterstützen würden.
Auch Theodor Codreanu spielt mit ähnlichen Vermutungen, indem er darauf hinweist, dass in Aufzeichnungen des Dichters Symbole der Freimaurer enthalten waren, die als Hinweise an/für die Nachwelt interpretiert wurden.
Außerdem wäre erwähnenwert, dass Dr. Iszak, ein aus Polen nach Botoșani zugezogener jüdischer Arzt, dem Patienten Eminescu gegenüber wohlwollend gesinnt war.
Hervorgehoben werden muss, dass nicht er, Dr. Iszak, allein, sondern in Übereinstimmung mit den Ärzten aus Jassy Eminescu die Quecksilberbehandlung verordnet hatte und zwar in der fälschlichen Annahme eines syphilitischen Knotens im Gehirn.
Maßgeblich erscheint jedoch, dass nach Bekanntgabe der Diagnose des Dr. Carl Wilhelm Hermann Nothnagel (* 28. September 1841 in Alt-Lietzegöricke in der Mark Brandenburg; † 7. Juli 1905 in Wien) 1887 in Wien, übereinstimmend mit Dr. Heinrich Obersteiner, Diagnose, die aus der Korrespondenz von Titu Maiorescu mit den Wiener Ärzten hervorgeht, und zwar, dass keine Lues-Erkrankung beim Dichter vorliege (aus der Korrespondenz zwischen Eminescus Schwester Harrieta und Dr. Iszak) dieser die Quecksilberbehandlung sofort eingestellt hatte, obwohl er persönlich von dieser überzeugt war.
1887 befand sich der Dichter in einem jämmerlichen Zustand in Boto{ani und wurde von seiner Schwester Harrieta und vom Dermatologen Dr. Francisc Iszak einer Behandlung mit Jod und Quecksilber unterzogen.
Harrieta hatte dem Dichter außerdem auch Morphium und Arsenspritzen verabreicht.
Eminescu wies auch Wunden an den Beinen auf, hervorgerufen von einem Leiden an Diabetes, damals noch nicht bekannt (wurde erst 1889 von Josef von Mering ( 1849-1908) und Oskar Minkowsky (1858-1931) nachgewiesen).
Außerdem klagte der Dichter auch über Wunden auf dem Kopf.
Dem Dichter wurde eine Behandlung mit Jod empfohlen. Für diese Behandlung wurden Eminescu von Titus Maiorescu aus einer Sammlung des Stadtrates Boto{ani 120 Lei zur Verfügung gestellt.
Auch an der Schule der Schönen Künste in Jassy wurde durch eine von Cornelia Emilian und L. A. Weitzseker initiierte Sammlung der Betrag von 2671 Lei und 35 Bani zusammengetragen.
Im Juli 1887 reist der Dichter in Begleitung des Urologen Dr. Grigore Focsa nach Wien, wo er von einer Kommission einer Untersuchung unterzogen und anschließend ein Aufenthalt in der Oberösterreichischen Kur-Stadt Bad Hall im Bezirk Steyr-Land im Traunviertel empfohlen wurde. In einigen Abhandlungen werden fälschlicherweise die Orte Bad Hall in Sachsen und Tirol angenommen.
Die oberösterreichische Kurstadt wurde auch von Kaiser Franz Josef I. gerne besucht. Auch Gustav Mahler gab in jener Zeit einige Konzerte in dem Kurort.
Der Dichter wurde nach Dan Toma Dulciu (*24.01. 1953) am 15.Juli 1887 in der Villa Rambl untergebracht, wo er bis zum 01.09.1887 verharrte, ohne dass jedoch eine Verbesserung seines Gesundheitszustandes eingetreten wäre.(„Eminescu - documente inedite”, nr. 19/2016, „Surse biografice eminesciene în fondul de manuscrise de la BCU ‚Carol I‘“, nr. 24 ian. 2017 {i nr. 25/februarie 2017: Revista „Cronica Timpului”).
Der Dichter kehrt zu seiner Schwester Harrieta nach Boto{ani zurück, die ihn unter der Betreuung von Dr. Iszak weiterhin – aber unbewusst – missbräuchlich mit Quecksilber, Morphium und Tabletten behandelte.
Festzuhalten wäre, dass beim Dichter 1887 (laut Ion Nica) eine Wasservergiftung diagnostiziert worden war, nach Einreibungen mit Quecksilber von Harrietta in Absprache mit Dr. Iszak persönlich verabreicht, die jedoch nicht letal waren.
Wahre Todesursache
1972 schlussfolgert Dr. Ion Nica („Eminescu: Structura somato-psihică“), dass der Dichter an einer Embolie gestorben wäre.
Ende April-Anfang Mai 1889 wird auf die typischen Vergiftungserscheinungen hingewiesen, die in den fachbezogenen Behandlungen als Wasservergiftungen bezeichnet wurden. Sie lösen psychische Störungen und kleine kardiale Synkopen aus, die häufig zu einer letalen kardialen Synkope führen können, so wie dies bei Eminescu der Fall war.
Bei der Autopsie haben das Herz und die Nieren eine verfettete Degenaration aufgewiesen, Folgen von Quecksilbervergiftungen. Der Tod war also beim Dichter als Quecksilbermyokarditis eingetreten.
Erwähnenswert ist, dass bei der dermatoskopischen Untersuchung das Gehirn ein normales Gewicht von 1490 Gramm, wie dies auch bei Schiller der Fall war, aufgewiesen hatte, Schiller jedoch an einem Lungenleiden erkrankt war und keine psychischen Störungen hatte.
Eminescu litt also an einer manisch-depressiven Psychose und keinesfalls an einer generellen progressiven Paralyse, wie das fälschlich hin und wieder behauptet worden war.
Demnach litt der Dichter an einer Quecksilbervergiftung mit letalem Ausgang, die aber nicht von der Behandlung des Dr. Iszak ausgegangen war, sondern von den Verordnungen durch Dr. [u]u, doch auch dieser agierte nicht auf Veranlassung durch „dunkle Mächte” und hatte keine Absicht, Eminescu auszuschalten, sondern hat diese Behandlung unabsichtlich durchgeführt, ohne die Folgen dieser Behandlung zu kennen.
Wenn Dr. Iszak den Fehler einer falschen Diagnosestellung vorgehalten werden kann, ist die Behandlung durch Dr. Șuțu nach seiner fachlichen Auffassung schwieriger zu verstehen. Während der ersten Krise des Dichters im Sommer 1883 befand der Dichter sich unter seiner Beobachtung und der Arzt diagnostizierte eine schwerwiegende akute Manie, die von den Wiener Ärzten bestätigt wurde, was nichts mit einer Syphiliserkrankung zu tun hatte.
Im Laufe der zweiten Krankenhauseinweisung am 23. März 1889, haben Dr. [u]u und Dr. Petrescu eine medizinische Diagnose erstellt, aus der klar hervorgeht, dass der Dichter nur an vorherrschenden manischen Symptomen leide. Dementsprechend wurde eine Demenz diagnostiziert, was heutzutage als chronische Manie einzustufen wäre.
Titu Maiorescu, ein ausgezeichneter Kenner psychischer Erkrankungen, die er als behandelte Stoffgebiete an der von ihm besuchten Wiener philosophischen und psychologischen Fakultät studierte hatte, sprach von einer in Demenz übergegangenen Manie. Demnach hatte er aufgrund dieser Diagnose keine zerebrale Syphilis verstanden, weil er diese Ätiologie nicht beim Dichter festgestellt hat.
Der Fehler von Dr. [u]u war ein doppelter; indem er bei Eminescu Demenz diagnostizierte, verwechselte er sie mit einer paralytischen, was daher die Quecksilberbehandlung zur Folge hatte, verabreicht bei der Behandlung von Syphilis, was beim Dichter nicht zutreffend war, wie das auch von den Ärzten aus Jassy und Dr. Iszak erkannt worden war.
Folglich war die Behandlung mit Quecksilber nicht geeignet, sodass Dr. Șuțu über die fortschreitende Erkrankung erstaunt war, dem Dichter die Lebenserwartung um zwei Jahre verlängert eingestuft und seine falsche Behandlungsmethode völlig vergessen hatte.
Erst 1888 gelang es Veronica Micle (1850-1889) den Dichter aus der Behandlung des Dr. Iszac zu befreien und nach Bukarest zu bringen, wo er am 15. Juni 1889 seine Seele aushauchte.
Doch kein politischer Mord
Wenn beim Patienten die von Quecksilber verursachten Vergiftungserscheinungen auftreten und Zitterzustände einsetzen, ist er verloren; die beim letzten Klinikaufenthalt des Dichters diesbezüglich aufgetretenen Zustände lassen uns schlussfolgern, dass die ihm verabreichten giftigen Dosen tödlich waren.
Alle mit Politik oder mit anderen Faktoren ins Spiel gebrachten Spekulationen haben mit dem Tod des Dichters nichts zu tun.
Eine Reihe rumänischer Spitzenintellektuelle wie z.B. Zigu Ornea (29.8.1930 – 14.11.2001), Augustin Buzura (22.9.1038-10.7.2017), [tefan Augustin Doina{ (26.04.1922-26.5.2002), Ion Negoițescu (10.8 1921–6.2.1993), Alexandru Paleologu (14.3.1919–2.9.2005) und andere haben eine wahre Bewegung gegen Eminescu ausgelöst.
So behauptet Zigu Ornea, dass Eminescus Ansichten, die rumänische Kultur betreffend nicht den heutigen Anschauungen (Maßstäben) entsprächen; während [t. A. Doina{ (1922-2002) den Dichter als „Protolegionär” bezeichnet. Doch die Vertreter dieser Anti-Eminescu-Bewegung hatten bzw. haben in ihrem Einflussbereich die bedeutendsten Kulturinstitutionen des Landes.
Obwohl eine andere, den Dichter unterstützende Bewegung, zur Verteidigung Eminescus eintritt, zieht diese diesbezüglich subjektive, wissenschaftlich nicht vertretbare Argumente heran. So wären erwähnenswert Nicolae Georgescu, „A doua Viață a lui Eminescu“ (Das zweite Lebens Eminescus), ed. Europa Nova, Bukarest, 1994 und Theodor Codreanu, „Dubla sacrificare a lui Eminescu“ (Die doppelte Opferung Eminescus), ed. Macarie, Târgoviște, 1997.
Die politische Beurteilung und Stigmatisierung des schöpferischen Werkes eines Genius bedeutet, ein geistiges Verbrechen zu begehen. Die auf diese Art und Weise begangenen Ausgrenzungsversuche eines nationalen Kultursymbols wie Eminescu ist der rumänischen Kultur unwürdig.
Zutreffend die Verse aus „Scrisoarea I“ (Der I. Brief) des Dichters, die da lauten:
…Ob du eine Welt erbautest, ob zerstörtest: über Taten,
Über Worte gleicherweise kullert Erde hin vom Spaten.
Wie die Hand, die nach des Weltalls Zepter langte, wie der Traum,
Der das weite All umspannte, all das hat im Sarge Raum...
Freilich, hinterm Leichenwagen folgt das schwarze Grabgeleite,
Welche Ironie, gelangweilt gehn die Blicke in die Weite...
Auf den aufgeworfnen Hügel steigt ein Gernegroß zum Schwätzen,
Nicht um dich zu feiern, sich nur möcht’ er in Relief gern setzen
In dem Schatten deines Namens.
Das ist das, was deiner harrt.
Doch gerechter ist die Nachwelt, meinst du... als die Gegenwart.
Dich bewundern werden, glaubst du, die dich nicht erreichen können?
Beifall werden sie gewisslich deinem Lebenslaufe gönnen,
Wenn er nur geschickt den Schluss zieht, dass auch du ein Mensch gewesen
Und durchaus nicht was Besondres...
Jedem schmeichelt es, zu lesen,
Dass du mehr nicht warst, als er ist.
In gelehrter Körperschaft Sitzen sie und blähn die Nüstern, hören blöd und gönnerhaft, Wenn man über dich grad redet. Zum Prinzip wird gleich erhoben
Mit ironischer Grimasse, dich nach Möglichkeit zu loben.
Also darf ein jeder meistern, kritisieren, kommentieren,
Und verfehlt ist, was den Köpfen allzuschwer ist zu kapieren...
Doch es fehlte noch die Würze. Und sie finden sie und schmücken Dir dein Leben mit Skandälchen, dunkeln Punkten, kleinen Tücken -
Das ja bringt dich ihnen näher...
Wenig kümmert sie das Licht, Das du in die Welt gestrahlt hast; doch Versäumnis deiner Pflicht,
Müdigkeit und Schuld und Schwäche, Halbes, Krankes, Faules, Taubes,
Das uns das Verhängnis mitgab, dir wie jedem Sohn des Staubes,
All die Kleinlichkeit, das Elend einer leiderfüllten Seele
Wird sie mehr interessieren als die geistigen Juwele.
Über Mauern, durch die Bäume, die die hellen Blüten regnen,
Fließt des Mondes sanftes Leuchten wie ein ruhevolles Segnen,
Holt aus nächtiger Erinnrung tausendfachen Sehnens Schmerzen;
Halb erstickt, aus Träumen zuckend, bluten leise sie im Herzen,
Denn zu unsres Innern Welten öffnest du uns, Mond, das Tor;
Löschen wir die Kerze, wachsen tausend Schatten rings empor...
Unermessne Wüsten weckst du auf zu nächtlichem Gefunkel; Stiller Quellen Gegenschimmern birgt der tiefen Wälder Dunkel!
Über wie viele Ozeane herrscht dein Licht so weit und breit,
Wenn du schwebst auf der bewegten Wasserflächeneinsamkeit,
Über alle die auf Erden sind beherrscht vom SchicksalsodScheint die Herrschaft deiner Strahlen und der Genius vom Tod.
(Deutsch von Christian W. Schenk)