Der interessierte Laie assoziiert mit dem Titel des Buches „Sprache und Identität im Bukowiner Judentum“ vielleicht die Poesie von Persönlichkeiten der Bukowina, dem Buchenland, wie den Czernowitzern Paul Celan oder Rose Ausländer. Zwar wird im geschichtlichen Abriss auf die Besonderheit dieser südöstlichsten deutschen Sprachinsel, den „Mythos Bukowina“ und der dort herrschenden Mehrsprachigkeit kurz eingegangen, aber das sprachliche Vermögen, die besondere Kultur oder narrative Ausdruckskraft der hier zu Wort kommenden ehemaligen Bukowiner spielen für diese Untersuchung nur eine untergeordnete Rolle.
Unter einer sprachbiografischen Analyse versteht man ein relativ junges Analyseinstrument, das sich im Rahmen der didaktisch-linguistischen neueren Migrationsforschung herausgebildet hat. Dabei geht es häufig um die Strategien und die autobiografischen Abläufe beim Spracherwerb vor dem Hintergrund der Mehrsprachigkeit, aber auch um die unterschiedliche emotionale Bewertung von Sprachen und somit um die Identifikation mit einer bestimmten Sprache wie beispielsweise mit der Muttersprache.
Die untersuchte Gruppe von vierzehn Bukowiner Juden, die zum Zeitpunkt der Studie 2011 bereits 80 bis 92 Jahre zählten und alle mittlerweile in Israel lebten, stellt aufgrund ihrer den Lebensumständen geschuldeten generellen Mehrsprachigkeit eine Besonderheit dar.
Als gemeinsamer Ausgangspunkt dieser Biografien steht der Erwerb der österreichisch-deutschen Hochsprache, die in der Donaumonarchie, trotz der hier herrschenden relativen kulturellen Toleranz, zunächst als die führende Sprache galt, während der sprachbiografische Gegenpol spätestens bei der Ankunft in Israel mit dem Erwerb des Hebräischen erreicht ist. Die besondere Rolle des Jiddischen auch in Hinsicht auf die Identifikation mit einer Sprache, wird ebenfalls untersucht. Die politisch-historischen Umwandlungen brachten je nach individueller Erfahrung mit Deportation, Okkupation oder Vertreibungen und Flucht die Notwendigkeit zum Erlernen weiterer Sprachen, wie Russisch, Rumänisch, Englisch, Französisch und Spanisch, wobei einige auch entsprechend der soziokulturellen Stellung im Laufe einer „regulären“ Erziehung erworben werden konnten. Ein Hauptdesiderat der vorliegenden Arbeit stellt die Erklärung für das häufig erstaunlich positive Verhältnis der Bukowiner Juden zur deutschen Sprache dar und ihre Pflege und Beibehaltung selbst nach Jahren noch in Israel, trotz der traumatischen Erlebnisse während der nationalsozialistischen Herrschaft.
In ihrer Herangehensweise versucht die Autorin, neben einem ausführlichen historischen Abriss, vor allem verschiedene wissenschaftstheoretische Definitionen und Begriffsklärungen vorzunehmen. So bietet sie alleine vier verschiedene Deutungsmuster für den Begriff „Identität“, aber auch was unter einem narrativen Interview oder einer autobiografischen Erzählung zu verstehen sei, wird erläutert. Berücksichtigung von traumatischen Erlebnissen, psychologischen Barrieren, kollektiver versus individueller Erinnerung bzw. Verdrängung wird in dieser Vorbereitung thematisiert. Allerdings scheint in dieser Konzeption der physische Zustand der immerhin sehr betagten Zielgruppe keinerlei Rolle zu spielen. Krankheiten wie Schlaganfälle oder beginnende Demenz, die sowohl die Gedächtnisleistung – Überlagerung von älteren Erinnerungsebenen zu Lasten jüngerer, partieller Verlust des Kurzzeitgedächtnisses –, aber auch das Sprachvermögen direkt angreifen können – Stichwort: Wortfindungsstörungen – finden keinerlei Erwähnung.
Der eigentliche, hier Korpus genannte Kern der Untersuchung umfasst keine 40 Seiten und letztlich 14 Interviewpartner. Dabei werden die meisten biografischen Angaben summarisch wiedergegeben. Die Transliteration der Tonbandaufnahmen erfolgt so authentisch wie möglich, d. h. bisweilen werden nicht verstandene Passagen oder Ausdrücke durch ?? gekennzeichnet oder Lücken durch / . Auf grammatikalische und lexikalische Richtigkeit wird keinerlei Wert gelegt. Die wörtlichen Zitate wurden nach ihrer Aussagekraft für den Spracherwerb beziehungsweise damit in Zusammenhang stehenden Schwierigkeiten, Erfolgen oder auch Aussagen, die Rückschlüsse auf die Wertschätzung einer Sprache erlauben, ausgewählt. Über Ernie S. (S.86), geboren 1927, wird gesagt, er verfüge „über ein sehr reflektiertes Verhältnis zu den von ihm erlernten Sprachen, so dass seine Erzählung ebenfalls etliche sprachbiografische Züge aufweist.“
„Mit den Eltern hab ich natürlich nur Deutsch gesprochen, ich denke heute auch Deutsch (...) Meine Eltern haben die deutsche Schule besucht. Ich nicht mehr, weil äh Rumänien wars und natürlich äh die Schule hat begonnen sagen wir äh nich / äh, aber schon im Kindergarten war es schon Rumänisch, nicht wahr. Aber äh Rumänisch war irgendwie die zweite Sprache, nicht, nicht die erste – die erste war die deutsche Sprache.“
Hingegen heißt es über Joseph W. (S. 89), dass er „nur sehr wenige sprachbiografisch relevante Informationen in seine Erzählung einbezieht,…“.
„Ich bin in einem Dorf geboren, einem wunderschönen Dorf, das heißt Moldoviţa im Süden der Bukowina. Das war ein Sommerfrischedorf und äh mein Vater hat ein, was man dort genannt hat, ein Kolonialgeschäft gehabt. Ein Geschäft für alles.“
Dieser Auszug kann vielleicht ein wenig verdeutlichen, worauf es der Sprachbiografie und Mehrsprachigkeitsforschung ankommt. Die sprachliche Qualität an sich ist nicht Gegenstand der Forschung. Die Betonung liegt darauf, wann, wie und unter welchen Bedingungen eine Sprache erlernt wird, welche Anerkennung sie erfährt – z. B. das geringe Ansehen des Jiddischen in einem deutschen oder selbst hebräischen Umfeld –, aber auch welche Vorteile (kulturelle Flexibilität) oder Nachteile (geringes sprachliches Niveau) sich aus einer Mehrsprachigkeit ergeben können. Dies wird in den weiteren theoretischen Kapiteln ausführlicher erläutert, um schließlich die Bezüge zu Sprache und Identität, konkret um „die Bedeutung der Sprache im Judentum“ oder „die identitätsstiftende Funktion der deutschen Sprache“ zu erörtern.
Die anschließende Sprachanalyse beschränkt sich vor allem auf das Verhältnis zur deutschen und hebräischen, in geringerem Umfang auch auf das zur jiddischen und rumänischen Sprache, da diese vier für die Heranbildung einer sprachlichen Identität als besonders prägend angesehen werden.
Nicht ganz überraschend kristallisieren sich in ihrem Fazit, neben einigen individuellen Abweichungen, zwei Verhaltensweisen heraus, die in Korrelation zum Einwanderungszeitpunkt nach Israel stehen.
Je später der Zeitpunkt der Einwanderung, je geringer die Vorbereitung im Elternhaus, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer engeren Bindung an das „muttersprachlich“ erworbene bzw. soziopolitisch gewollte Deutsch. Umgekehrt liegt es an der bereits religiös und/oder zionistisch motivierten Vorbereitung und der in jungen Jahren erfolgten Einwanderung, wenn die sprachliche Integration in Israel besonders erfolgreich verläuft und damit die Bindung an das Deutsche schwindet bzw. bewusst abgebrochen wird. Dass darüber hinaus eine positivere Gesamthaltung zur deutschen Sprache herrschte als beispielsweise für andere Juden, die direkt aus dem Deutschen Reich kamen, mag der besonderen und andersgearteten Ausgangslage in der toleranteren Bukowina geschuldet sein, was hier mit der „bürgerlich-liberalen Wertehaltung“ eines „kollektiven Gedächtnisses der Bukowiner Intelligenz“ erklärt wird.

Sprache und Identität im Bukowiner Judentum
Eine sprachbiografische Analyse von Tatjana Geschwill
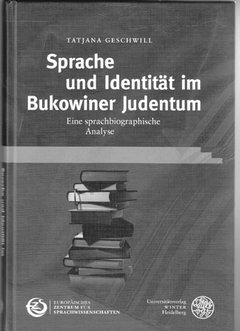
Tatjana Geschwill: „Sprache und Identität im Bukowiner Judentum. Eine sprachbiographische Analyse“, Universitätsverlag Winter Heidelberg 2015. 214 S. Reihe: Schriften des Europäischen Zentrums für Sprachwissenschaften (EZS), Band:3. ISBN: 978-3-8253-6436-6




