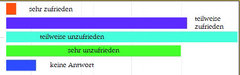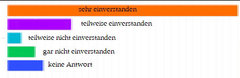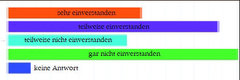„Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird brüchig und diese Entwicklung ist eng mit Unsicherheit, Sorge und Angst vor dem sozialen und kulturellen Abstieg verbunden“, schreibt der Politikwissenschaftler Thorsten Schäfer-Gümbel in einem Aufsatz mit dem Titel: „Alle Menschen sind frei und gleich. Schutz und Gefährdung der Demokratie.“ Könnte dieses „brüchig werden“ für die in Rumänien in der Gesellschaft verbreitete passiv-aggressive Haltung eine Erklärung liefern – oder sind da auch andere Kräfte im Spiel? Und: Was tun mit der heißen Kartoffel?
Über das rumänische Schulwesen und dessen Modernisierung sind in den letzten 30 Jahren Ströme von Tinte im off- und online geflossen. Es stehen sich, auf oft verhärteten Fronten, Lehrer, Eltern, Schüler und Politiker gegenüber. Die Argumente jeder Seite umfassen das gesamte Spektrum von objektiver Analyse bis zur emotionalen Reaktion. Über Bildung hat jeder was zu sagen. Jeder hat in der einen oder anderen Weise seine nicht anfechtbare Expertise gesammelt. Und trotzdem bewegen sich die Zahnräder nicht wie in einem zusammenhängenden System, geölt und ineinandergreifend, sondern jedes dreht sich um die eigene Achse und erwartet das ein Deus ex Machina mit einer wunderwirkenden Hand magisch alles zusammenfügt.
Natürlich bewirken Bilder mit einer verzweifelten Lehrerin in einer Schule in Petriceaua, die standhaft versucht ihre Stunde zu halten, während zwei halbstarke Jugendliche hinter ihrem Rücken ihre Vergewaltigung simulieren, emotionale Reaktionen. Schuldzuweisungen sind von allen Seiten zu hören. Lehrer betonen ihre Mittel- und Machtlosigkeit angesichts derartiger Störenfriede. Eltern sprechen von dem niedrigen Bildungsniveau der Lehrer und ihrer Unfähigkeit, durch interessante Stunden solchen Verhaltensweisen vorzubeugen. Wiederum reden andere von einem Mangel an emotionaler Intelligenz im rumänischen Bildungswesen. Von schulischer Seite, aber nicht nur, wird der Ball den Eltern zurückgeworfen und man erwähnt die berühmten „{apte ani de acas²” (die sieben Jahre zu Hause), denn die Schule soll Wissen vermitteln und nicht Erziehung betreiben. Und im gesamten Chor dürfen die Stimmen nicht fehlen, die von den guten alten Zeiten schwärmen, als die Lehrer ihren Respekt mit Ohrfeigen oder mit Ohrenlangziehen einfordern konnten.
In dem ganzen Tohuwabohu verhalten sich die Entscheidungsträger wie der Rabbi, der in einem Ehestreit zuerst der Gattin recht gibt, dann dem Gatten, und als er von einem Außenstehenden angesprochen wird, dass er doch nicht beiden recht geben könne, antwortet er: „Auch Sie haben recht.“ Unklar bleibt, wer letztendlich die heiße Kartoffel aus dem Feuer holen soll.
Doch vielleicht liegt das Problem auch ganz wo-anders. Vielleicht ist nicht ein neues Bildungsgesetz die eierlegende Wollmilchsau, die alles lösen kann. Es wäre vielleicht an der Zeit, dass sich die verschiedenen Parteien an den Tisch setzen und sich der Frage stellen, warum der soziale Vertrag, welcher die Bildung der zukünftigen Generationen mitbeinhaltet, nicht mehr funktioniert.
Dass die Nutznießer dieses Vertrags, die Kinder in der Institution Schule nur noch eine lästige Pflicht sehen, ist eine offensichtliche Tatsache. Höflicher oder ungehobelter erfüllen die Schüler nach eigenem Ermessen diese ihnen auferlegte Pflicht, mit der sie oft sowohl von den Eltern, wie auch von den Lehrern alleine gelassen werden. Dass dabei die Begeisterung fehlt, kann man ihnen fast nicht mehr vorwerfen. Der Konflikt zwischen der Wirklichkeit, in der sie leben, und dem Schulsystem wird von Tag zu Tag stärker. Ihr eigenes Weltbild hat mit dem in der Schule Erlebten und Gelernten so gut wie keinen gemeinsamen Nenner. Dabei sollte erwähnt werden, dass zum Schulsystem auch die Realität, in der die Eltern dieser Schüler leben, dazugehört. Das Misstrauen zum System wird den Kindern gewöhnlich von den eigenen Eltern mit auf den Weg gegeben.
Das parallele Bildungswesen
Als bestes Beispiel dafür gilt das parallel dazu verlaufende Bildungswesen: Nachhilfestunden! Es wäre unverantwortlich, die Existenz dieser sozialen Wirklichkeit nur den Lehrern, mit der Begründung eines Nebenverdienstes, in die Schuhe zu schieben. Das System wird sehr oft von den Eltern gefördert und mitgetragen. Was aber wird dabei einem sieben- oder achtjährigen Kind vermittelt? Egal was und wie die Person am Katheder in den Stunden, die du in der Schule verbringen musst (sic!), dir erzählt, es taugt eh nichts, darum musst du halt in die Nachhilfe. Und das wird dem Kind dann Tag für Tag für die nächsten zwölf Jahre vermittelt - und es erklärt nicht nur seine eigene ablehnende Haltung zum System als solches, sondern auch die Missachtung den Personen gegenüber, die dieses System ihm gegenüber tagtäglich verkörpern und vertreten.
Der Fall in Petriceaua oder der Fall der mit dem Messer angegriffenen Lehrerin in einer angesehenen Bukarester Schule sollten als Symptome eines blockierten Sozialsystems betrachtet werden, in welchem auf Vertrauen aufbauende Beziehungen längst nicht mehr zur Norm gehören. In der rumänischen Gesellschaft sind leider Misstrauen, Neid und Selbstbehauptung die treibenden Kräfte geworden. Zugleich bleibt der Blick auf die eigenen Bedürfnisse und die eigene nahe Zukunft beschränkt. Alles andere wird hinter den berühmten „man müsste“ und „man sollte“ von sich geschoben.
Ein missverstandener und übertriebener Individualismus bestimmt die zwischengesellschaftlichen Beziehungen im Rumänien. Ich möchte hier nicht in den Chor jener, die den Werte- und Moralmangel beklagen, einstimmen. Sowohl Werte wie auch Moral sind in der rumänischen Gesellschaft vorhanden und verankert, es gilt nur, den Mut zur realen Auslebung derselben zu finden. Es reicht nicht, diese in die Welt hinauszuposaunen und dabei die anderen machen lassen.
Die partizipative Komponente kam zu kurz
Rumänien hat Demokratie mittels eines Learning-by-Doing-Prozesses erlernt. Dabei ist die partizipative Komponente leider zu kurz gekommen. Ein Blick auf die im allgemeinen niedrigen Wahlbeteiligungen in den letzten 30 Jahren genügt, um dieses zu verstehen. Unter Wahlteilnahme verstehen viele Rumänen nicht die Chance der Mitbestimmung des eigenen Schicksals, sondern, dass man irgendwelchen Korrupten „da oben“ den Weg zum Geldhahn ebnet. Zugegeben, dass diese Wahrnehmung auch der rumänischen politischen Klasse zu verdanken ist, die in nicht wenigen Fällen bewusst zu einer Polarisierung der Gesellschaft beigetragen hat, was wiederum das allgemeine Misstrauen gefördert hat. Und so lernte man, wegzublicken, nichts zu hören und nichts zu sagen. Auf übertriebene Weise wird diese Distanz zu den Mitmenschen und den Institutionen des demokratischen Staates als kritische Haltung gegenüber dem System als solches gedeutet und gelebt. Man erhofft sich, durch Passivität ein Reboot des Systems zu erzwingen, und vergisst dabei, das eben dieses „dolce far niente“ zu einer Verselbstständigung des Systems außerhalb jeder Form von Kontrolle führen kann.
Die Polarisierung der Gesellschaft führt zu Misstrauen und Misstrauen zu Aggressivität. Aggressivität ihrerseits entmachtet eine der treibenden demokratischen Kräfte: den Kompromiss. In der heutigen rumänischen Gesellschaft ist „der Kompromiss“ negativ besetzt, da im gängigen Verständnis sich letztendlich irgendwie zwei oder mehrere Verlierer einig werden müssen. Niemand gewinnt, alle verlieren. So ist auch die Haltung des rumänischen Wählers zu verstehen: zu oft musste er Kompromisse eingehen und mit seiner Stimme das kleinere Übel legitimieren. Es bedarf eines tiefgreifenden Umdenkprozesses, um diesen negativen Beigeschmack des Kompromisses, in Richtung einer Win-win Situation, umzupolen. Dieses wäre ein möglicher Ansatz für die Neugestaltung der sozialen Vereinbarung, derer fester Bestandteil auch das rumänische Bildungswesen ist. Die Lehrer sind nicht besser oder schlechter als anderswo, die Schüler sind nicht aggressiver oder apathischer, die Eltern nicht anspruchsvoller, doch könnte eine Neudefinierung der unterschiedlichen Positionen eine Änderung von innen mit sich bringen, die von keinem Bildungsgesetz erzwungen oder eingeleitet werden kann.
Die Schlagzeilen zu den Gewalttaten in den beiden Schulen sind inzwischen verblasst und das Mühlrad dreht sich weiter. Die unterschwellige Aggressivität in der rumänischen Gesellschaft, wo jeder ein potentieller Erzfeind sein könnte, schlägt weiterhin seine Kreise und wird von Generation zu Generation weitergegeben. 2024 wird durch die anstehenden fünf Urnengänge sicher eine allgemeine Steigerung dieser aggressiven Haltung mit sich bringen. Zwischendurch könnte aber jeder an seiner Kompromissbereitschaft arbeiten.