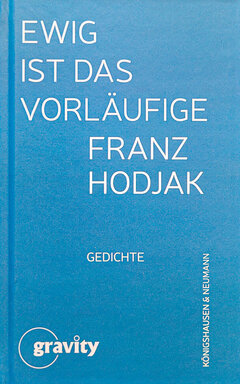Der neue Hodjak ist da. Nun ja, es ist der vorläufig neue Hodjak-Gedichtband – bis zum nächsten. Dabei gab es lange Jahre, da hätte man meinen können, es käme kein neuer Hodjak mehr. Dabei hätte man wissen müssen, dass Franz Hodjak den Alltagsgeschichten stets eine unabsehbare Wende verleiht. Bereits als seine Landsleute „kopflos“ die Heimat mit den Beinen verließen, während der Kopf daheim blieb, schrieb er daheim weiter. Er publizierte auch nach der Dezemberwende weiterhin u. a. in der neu aufgelegten Literaturzeitschrift seiner Heimatstadt, fuhr später nach Klagenfurt und gewann beim hoch geschätzten Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb den Preis des Landes Kärnten. Noch später erschien seine Prosa beim renommierten Suhrkamp-Verlag, damals in Frankfurt a.M. Inzwischen lebt er in der dortigen Region inmitten seiner Familie. Schreiben tut er weiter: Aphorismen und Lyrik. Neu erschienen ist nun quasi eine Kombination derer.
Nichts hält länger als ein Provisorium, pflegte man während der Mangelwirtschaft des kommunistischen Rumäniens zu sagen. Doch Hodjak wäre nicht Hodjak, wenn er jenem Bonmot nicht mit einer kleinen Wortwende einen tieferen Sinn verleihen würde. „Ewig ist das Vorläufige“ titelt der Dichter und sinniert betagt nicht nur über die Vergänglichkeit der Zeit, sondern beschwichtigt auch, relativiert das unangenehme Gefühl des Unvollendeten oder negativer Zustände, die ja nur einstweilig sind. Die Siebenbürger Sachsen sind aus ihrer jahrhundertealten Heimat ausgewandert? Ach, das ist ja nur vorläufig. Man kann sich im Lesesessel entspannt zurücklehnen. Vermeintlich. Denn sie werden nicht in ihren gemochten Karpatenbogen zurück wandern, sondern pragmatisch wieder Richtung Westen. In großen Schiffskolonnen ziehen sie – nach der großen Gletscherschmelze – nach Grönland, soweit nicht von Trump annektiert. Später steht es dann in den Urkunden und Chroniken am Nussbach geschrieben: Die Grönlanddeutschen stammen ursprünglich aus der Alt-Zibin-Gegend im Siebenbürgischen Hochland.
Franz Hodjak bricht Alltagsnarative auf:
„... ich bin
auch nicht der Meinung, dass alles so
aufhören muss, wie es aufhört.
Vielleicht wären wir bitter enttäuscht,
wenn wir eines Tages Atlantis doch
entdecken, denke ich. Und was denkst du?“
Sein Parlando-Ton schafft wie beiläufig Nähe, doch Gelegenheitslyrik ist es nicht. Wer führt denn schon einen Monolog bestehend aus der Aneinanderreihung von Aphorismen? Erst der Schlussvers macht das Gedicht, verführt mit jener Aneinanderreihung von Aphorismen und letztendlich schlüssigem Gesamtbild den Leser zur Kontemplation. „Egal, wie lang die Sätze werden, es müssen immer genug Wörter übrig bleiben für eine letzte Möglichkeit.“
Wörter stehen in Hodjaks Lyrik nicht als Wörter, die schön klingen, die sich reimen, als pfiffige Komposita. Jedes, wirklich jedes Wort, und mag es noch so gängig sein, ist gut durchdacht gewählt und platziert. Beispielhaft sei das Kurzgedicht „Leerer Korridor“ genannt. Es wird mit der Frage eingeleitet „Wieso ist der Korridor so leer?“ Die Antwort folgt nur fünf Verse später als rhetorische Frage: „Weshalb ist der Korridor so leer?“ Im unterschiedlichen Interrogativpronomen liegt die Antwort jener vordergründig gleichen Frage verborgen – und natürlich in den Versen dazwischen.
Der Autor verleiht mit der gewählten Syntax seinen Aphorismen einen elegant geschwungenen Drall mit präzise angewinkelten Ambivalenzen. Harte Brüche heben in seinen Versen pointiert Essenzielles hervor. Nach schmückenden Wortfüllungen steht dem Autor nicht der Sinn, so dass er in seinen stark verdichteten Texten lieber auf die Konjunktion „und“ zurückgreift, was ferner dem erwähnten Plauderton zweckdienlich ist.
Franz Hodjak schreibt gelegentlich mit erkenntnisreicher Melancholie – aber mit spitzfedriger Ironie lebt es sich leichter. Beispiel: „Die einen, die andern“
„Wer sich in die erste Reihe setzt, will
gesehen werden. Wer sich in die letzte Reihe setzt,
will all jene sehen,
die gesehen werden wollen. Und
die einen kommen bloß, weil die andern
da sind, und die anderen gehen bloß, wenn
auch die einen gehen. Die einen sehen sich mit
den Augen der anderen, und wenn
die anderen nicht da sind, sehen beide nichts. (...)“
Das lyrische Ich gesteht sich ein: „ich nehme das Leben nicht zu persönlich“. „Hauptsache, man ist da, und zwar so da, wie niemand da ist, wenn es um das da sein geht.“
Neigt sich der Alltag mit so manchem Ärgernis seinem Ende zu, so ist es gut, ein gutes Buch am Nachttisch liegen zu haben, wie vorliegenden Gedichtband. Denn:
„Wie jeder habe auch ich
die Erfahrung gemacht, wenn es nicht klappt,
klappt es auch mit den kleinen Träumen
genau so wenig wie mit den großen. Und jeden
Abend verlässt mich das, woran ich mich
festhalte, doch am Morgen ist es wieder da.“
Diese Lyrik hilft eingefahrene Alltagsnarrative zu überdenken und neu zu gewichten, die Dinge als vorläufig und damit vorübergehend nicht so schwer zu nehmen; nachts die Gedanken urbar machen für den Folgetag.
Auch bietet sich diese Lyrik als Wegbegleiter tagsüber an, z. B. in der U-Bahn, um auf dem Weg zur Arbeit zu lesen: „Meist erwarten wir von den Möglichkeiten alles und von uns nichts.“ Man muss die Dinge schon selber in die Hand nehmen, da hilft auch kein beten: „Die Frage, weshalb Gott sich versteckt vor uns, ist überholt.“ Das gilt auch am letzten Wochen- und Ruhetag: „Läuten die Sonntagsglocken, taucht das Gefühl auf, ein Falschparker nimmt meinem Leben den Platz weg.“
Dafür, dass „entweder Gott eine Mogelpackung (ist) oder ich“(S. 22), setzt sich Franz Hodjak dann doch recht häufig mit Gott auseinander, oder der damit verbundenen Hoffnung, wie bei Ikarus. In so manchem Bewusstseinstrom oder Empfindungen des lyrischen Ichs halten nicht Gut und Böse die Balance: „Der Himmel ist leer, und der Teufel springt von einer Waagschale in die andere, um die Welt im Gleichgewicht zu halten.“ Dennoch: als zynischer Nihilist darf Franz Hodjak nicht missverstanden werden. Auf die faustsche Frage, was am Anfang stand, sieht er nicht das Wort, „das viele ausschließt“, sondern die Tat und den Erkenntnisgewinn. Oder aber, jene Frage nach dem Anfang ist wenig relevant. „Das Sein ist da, um das Werden müssen wir uns kümmern.“ Und mahnend fügt er hinzu: „Die Leere, in der wir uns bewegen, halten wir meist für die große Freiheit.“ Unser individueller Platz im Miteinander und wie wir ihn ausfüllen, macht uns aus. Kultur, schöngeistige Kunst wie auch – gerade besonders aktuell – Kommunikationskultur, bringt Menschen dazu, sich zur Gesellschaft hin zu öffnen. Diese Gedichtsammlung ist wie ein Handbuch dafür, nicht zu verzagen, sich nicht blenden zu lassen, achtsam zu leben. Denn: „Nur wer richtig liebt, schafft es, bis zuletzt schwach zu sein.“ Dieses Buch glänzt mit intelligenter Libido eines Altmeisters der Aphoristik.
„... Ich glaube, es gibt mehr Dinge,
von denen wir nur das Gegenteil
kennen wie Perfektion, Glück, Überschuss
oder Heimat.“
Und da ist es, das Wort, das den Deutschen in und aus Rumänien so viel bedeutet. „Mein Geburtshaus erkundigt sich bei der Stadt, in welcher Welt ich nun lebe.“ Blickt man in die Geburtsstadt von Franz Hodjak zurück, so findet man seine Kurzprosa bereits in Ausgabe Nr. 2 (Mai/1990) der Hermannstädter Litetaturzeitschrift „Euphorion“, die nach der Dezemberwende eine Neuauflage erfuhr und seither erscheint. Entnommen seinem Band „An einem Ecktisch“ (1984) wird in „Tills Onkel“ die (Kurz-)Geschichte eines heranwachsenden Waisenjungen erzählt, den die (Sonntags-)Hoffnung auf seinen Onkel Woche für Woche aufrecht hält, bis er sein Leben in die Hand nimmt, bzw. nehmen kann – ohne jenem Hoffnungsträger. Ist die Welt seit 1984 besser/anders geworden? „Man freut sich auf die Täuschungen am Wochenende, und am Montag lässt man über die Erinnerungen Lorbeer wachsen. Ewig ist das Vorläufige“, schreibt der Autor heutzutage.
Was bedeutet die rumäniendeutsche literarische Herkunft für die heutige Literatur Franz Hodjaks? Nichts. Alles. Man kann den neuen Gedichtband lesen, auch ohne jeglichen Bezug zur Heimatregion des Autors zu haben. Man könnte den neuen Gedichtband als inexistent nicht lesen, gäbe es jene literarische Herkunft nicht.
Im Übrigen gab es Grönlanddeutsche tatsächlich: Es waren protestantische Missionare, aber keine Honterianer. Und da Franz Hodjak eher über gegenwärtige Beobachtungen sinniert, hat er nicht über zukünftige Grönlanddeutsche geschrieben – vorläufig.
Der Gedichtband „Ewig ist das Vorläufige“ ist nun passend im Würzburger Verlag Könighausen & Neumann erschienen, der 2023 auch Franz Hodjaks Anthologie mit Aphorismen „Das Glas gibt dem Wein die gewünschte Form“ herausgebracht hat. Buvons bien!