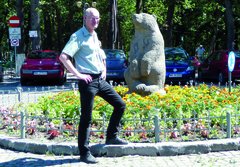„Als ich 1979 von zu Hause auszog, um in München zu studieren, brach meine Mutter, die sonst kaum Gefühlsregungen zeigte, in Tränen aus. Über dreißig Jahre später machte ich mich auf den Weg nach Rumänien und erntete im Freundes- und Bekanntenkreis überwiegend verständnisloses Kopfschütteln. Tränen gab es Gott sei Dank keine. Dazwischen lagen Familiengründung, 25 Jahre Tätigkeit in der eigenen Buchhandlung, Ehescheidung und am Schluss die Erkenntnis, in Deutschland keine berufliche Perspektive mehr zu haben.
Bereits Jahre vor Schließung der Buchhandlung hatte ich immer wieder versucht, in ein Angestelltenverhältnis zu wechseln, obwohl ich mit Leib und Seele mein eigener Chef war, und es keinen Tag gab, an dem ich mit Bauchgrimmen in den Laden ging. Jedoch hatte ich im Laufe der Zeit erkennen müssen, dass mit dem Laden keine Absicherung für den Krankheitsfall bzw. den Ruhestand zu erwirtschaften war.
Weit und breit kein Job in Sicht
Ein Jahr lang hatte ich in der Firma eines Freundes in Frankfurt gearbeitet. Das Experiment endete in Ernüchterung und der Erkenntnis, meinem Ziel keinen Schritt näher gekommen zu sein. Mit der Zeit musste ich auch einsehen, von potentiellen Arbeitgebern schon aufgrund meines Alters aussortiert zu werden. Das Ende meiner Selbstständigkeit kam schließlich schneller als gedacht: Der Vermieter des Ladens kündigte den Mietvertrag. Einen nochmaligen Umzug an einen anderen Standort - es wäre der vierte gewesen - wollte ich mir nicht mehr zumuten; die Ertragslage hätte sich nicht entscheidend verbessert. So gab ich mir noch zwei weitere Jahre, um eine passende Tätigkeit zu finden. Alles was sich ergab waren Gelegenheitsjobs ohne längerfristige Perspektive, sodass am Ende der Entschluss feststand, auszuwandern. Für ein Leben in Deutschland hätte mich mein angespartes Kapital vielleicht noch zehn Jahre über Wasser gehalten. Also blieb nur Hartz IV oder der Umzug in ein Land mit niedrigeren Lebenshaltungskosten übrig.
Aufbruch in ein neues Leben
Bereits im Vorfeld hatte ich mich in Siebenbürgen umgeschaut und überwiegend positive Eindrücke gewonnen. Mir war klar, dass trotz intensiver Vorbereitung immer noch das Risiko des Scheiterns bestand. Allerdings hatte ich bereits mit dem Sprung in die Selbstständigkeit gezeigt, kein Wagnis zu scheuen.
Über eine Bekannte hatte ich einige rumänische Adressen erhalten, und so ergab sich eine Gelegenheit, in der Ortschaft Dealu im Bezirk Harghita ein Grundstück zu erwerben. Der Besitzer war gleichzeitig Bauunternehmer, sodass ich innerhalb eines dreiviertel Jahres meine Zelte in Deutschland abbrechen und ein Haus in Rumänien beziehen konnte. Unvorhergesehenerweise war ich allerdings ausgerechnet in der ungarischen Gegend gelandet, sodass mein Selbststudium im Rumänischen noch um die ungarische Sprache erweitert werden musste. Zeit hatte ich ja jetzt zur Genüge.
Nun kamen die ersten Kontakte zustande. Mit einer Mischung aus Respekt und ungläubigem Staunen wurde man betrachtet. „Was will der Deutsche hier eigentlich?“ mögen sich viele der Dorfbewohner gefragt haben. Was ich nie erwartet hatte: Einige waren stolz darauf, einen Deutschen als Mitbürger zu haben. Ich wurde vom Bürgermeister empfangen; die Formalitäten waren - mit Ausnahme der Aufenthaltsgenehmigung - schnell erledigt. Es hätte fast nicht besser laufen können.
Anfangs gewöhnungsbedürftig...
An eine Eigenart musste ich mich allerdings mit der Zeit erst gewöhnen: Abmachungen - auch in schriftlicher Form - werden, vor allem wenn es um Geschäfte geht, selten eingehalten. So verlangte der Bauunternehmer trotz anderslautender Vertragsklauseln Bezahlung für Leistungen, die eigentlich im Kaufpreis enthalten waren. Eine Weile sah ich mir das an. Doch irgendwann wurde es mir zu viel - und nach meiner Beschwerde musste ich mich mit dem Hinweis begnügen, dass der Vertrag ja nur Papier, also offensichtlich nichts wert war. Ähnlich erging es mir mit Kostenvoranschlägen.
Andererseits habe ich auch viel Hilfsbereitschaft erfahren, ohne dass eine Gegenleistung - in welcher Form auch immer - erwartet worden wäre. So entwickelte sich die Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung zu einem Hindernislauf durch die rumänische Bürokratie, den ich ohne die Mithilfe eines Bekannten nicht gemeistert hätte. Eine besondere Erwähnung gebührt meiner 75-jährigen Nachbarin, der ich nach meinem Einzug die Zweitschlüssel mit der Bitte übergab, während meiner Abwesenheit doch ein Auge auf mein Grundstück zu haben. So sammelt sie die herabgefallenen Nüsse auf, räumt den Schnee aus der Einfahrt und steht regelmäßig mit irgendwelchen Backwaren vor meiner Tür. Meine Angebote zur Mithilfe hingegen werden nur selten angenommen. Man hat allgemein das Gefühl, die Leute fürchten, in Abhängigkeit zu geraten.
Als Deutschlehrer in der neuen Heimat
Meinen Job als Deutschlehrer im Bildungshaus in Gheorgheni bekam ich durch die Vermittlung eines ehemaligen Schülers dieser Einrichtung. Dort gefiel es mir sehr gut, man war rundum versorgt und es war eine willkommene Abwechslung zum Dorfleben. Die jungen Leute absolvierten dort einen achtwöchigen Deutschkurs als Vorbereitung auf ein Praktikum in Deutschland. Die Kollegen waren pensionierte deutsche Lehrer. Mit ihnen, dem Personal und den Schülern klappte die Zusammenarbeit hervorragend, und in der Freizeit konnte ich noch die Umgebung - wie den Mördersee/Lacu Roșu - erkunden.
Leider hat sich das Konzept auf Dauer nicht halten können. Mit der Zeit gingen der Schule nämlich die Schüler aus. Das mag daran liegen, dass es mittlerweile andere Vermittler gibt, die ganze Busladungen von Arbeitern zum Beispiel in die Landwirtschaft oder zum Messebau in den Westen vermitteln. Da reicht es dann aus, wenn einer halbwegs Deutsch spricht. Kein Wunder, dass sich rumänische Unternehmer beklagen, keine guten Arbeiter zu finden; bei dem niedrigen rumänischen Lohnniveau und der Aussicht, in Westeuropa wesentlich mehr zu verdienen, nicht allzu verwunderlich.
Erste Freunde, kleine Kulturschocks
In der Schule lernte ich meine zeitweilige Freundin und damit natürlich auch deren Familie mit Verwandtschaft kennen, was sich positiv auf meine Ungarisch-Kenntnisse auswirkte. Julia schleppte mich natürlich auf sämtliche Feste - Taufen, Hochzeiten etc. - mit. Das war zu Anfang recht nett und interessant. Es wird ausgiebigst gefeiert, mit Tanz, Essen und Trinken bis in den frühen Morgen. Allerdings bin ich wenig trinkfest und alles andere als eine Nachteule, sodass ich mich schon immer viel zu früh verabschieden wollte, was allerdings nicht der Grund für das Ende dieser Beziehung war. An Silvester wird um 0.00 Uhr das Szeklerlied angestimmt und eine Stunde später, also um 0.00 Uhr ungarischer Zeit, die Ungarnhymne. Das war beim ersten Mal etwas peinlich, weil ich den Text nicht konnte - ich bringe mit Mühe gerade mal das Deutschlandlied zustande. Im nächsten Jahr hatte ich mir dann sicherheitshalber einen Spickzettel geschrieben.Als gewöhnungsbedürftig erwiesen sich die Grußformalitäten. Gilt es in Deutschland als Todsünde, der Frau nicht als erstes die Hand zu reichen, ist es bei den Ungarn anders. Schon in der Schule in Gheorgheni hatte ich bemerkt, dass ein Schüler morgens das Klassenzimmer betrat und zunächst reihum ging, um nur den bereits anwesenden Männern die Hand zu geben. Ich selbst hatte bei zufälligen Treffen mit Ehepaaren auf der Straße selbstverständlich beiden die Hände geschüttelt, erntete aber manchmal von der Frau einen entsetzt-verständnislosen Blick. Also: Frauen kriegen prinzipiell nur bei der ersten Vorstellung die Hand. Die nächste Lektion war der Wangenkuss. Franzosen als embrasser durchaus geläufig, verlangt er dem distanzierten Deutschen - dem verschlossenen Franken sowieso - einige Überwindung ab.
Schlussgedanken – ein wenig politisch
Zum Schluss muss es nun politisch werden. Auf strikte Ablehnung stößt bei den Ungarn die deutsche Asylpolitik, sicherlich auch infolge einer entsprechenden Berichterstattung in den Medien. Dabei flüchteten tausende Ungarn nach dem Volksaufstand 1956 in den Westen und profitierten von der jetzt von ihnen so gescholtenen Aufnahmepraxis.
Bei Gesprächen hat man manchmal den Eindruck, dass ein Groß-Ungarn mit den Grenzen von vor dem ersten Weltkrieg herbeigesehnt wird. Entsprechende Landkarten gibt es nach wie vor zu kaufen. Dabei sollten Grenzen in Europa nun wirklich keine Rolle mehr spielen. Die rumänische Sprache - obligatorisches Unterrichtsfach in der Schule - wird nur widerwillig und im äußersten Notfall gesprochen, ungarisches Brauchtum hingegen intensivst gepflegt.
Im Nachlass meines Großvaters fand ich den Reisepass meiner Urgroßmutter von 1929. Auf dem Titelblatt steht „Deutsches Reich“; im Inneren ist unter Staatsangehörigkeit vermerkt: Bayern. Mein eigener Reisepass, 83 Jahre später ausgestellt, ist überschrieben mit: Europäische Union - Bundesrepublik Deutschland. Als ich die Verwandtschaft meiner Exfrau im Bayerischen Wald befragte, als was sie sich fühlten, hieß es übereinstimmend: „Wir sind zuerst Bayern, dann Deutsche.“ Wäre es nicht wunderbar, wir würden Konkurrenzdenken, Machtstreben, Überlegenheitsgetue und Nationalfixiertheit ablegen und den Mitmenschen unabhängig von seinem Wohnort als gleichberechtigten Partner mit seinen Fähigkeiten, aber auch Schwächen akzeptieren und respektieren? Wahrscheinlich aber braucht der Mensch für sein Ego ein gewisses Überlegenheitsgefühl - und sei es die Überzeugung, sich der besseren Fußballmannschaft verschrieben zu haben. Vielleicht werden erst unsere Enkel mit Überzeugung und ganz selbstverständlich sagen: „Wir sind Europäer.“
Jürgen Fink wurde 1956 in Nürnberg geboren, wuchs in Erlangen auf und ging auch dort zur Schule. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und Anglistik. Von 1985 bis 2009 war er selbstständiger Buchhändler in Fürth (Bayern). Er lebt seit 2013 in Dealu/Oroszhegy (Harghita).