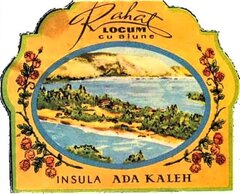Wenn man die Donaustraße DN 57 von Neumoldowa/Moldova Nou² nach Or{ova/Orschowa abfährt und die (immer noch nicht fertig gebauten) Schutzanlagen gegen Geröllschlag im Raum des ehemaligen Industrie-Kohlenverlade-Hafens Cozla bei Berzasca inmitten des Donaudurchbruchs beim Eisernen Tor hinter sich gebracht hat, tauchen vor den Augen jedes aufmerksamen Beobachters am linken Donauufer, rechterhand der Fahrtrichtung und auf den dortigen winzigen, aber fruchtbaren Terrassen, die den Donaustausee Eisernes Tor I flankieren, kleine Obstplantagen auf, manche davon mit Donauwasser bewässert, bei anderen stehen kleine Hütten, viele davon mit großzügigen Rauchabzügen. Sie deuten für den Kenner auf die Existenz von Schnapskesseln hin...
Es sind ziemlich junge Feigenplantagen der Bewohner – Serben und Rumänen – der Gemeinde Svini]a, der ersten, am weitesten westlich gelegenen Ortschaft, die man bei der administrativen Neuaufteilung Rumäniens vom 16. Februar 1968 unter Ceau{escu dem östlichen Nachbarkreis des Banater Berglands, Mehedin]i, also weg vom Banat und hin zu Oltenien, zugeschlagen hat, zusammen mit mehreren Tschechensiedlungen, wie Eibenthal, Schumitza, und dem gesamten Südrand der westlichen Ausläufer der Südkarpaten, bis hin zum einst Banater Orschowa, wo noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts rund ein Dutzend deutsche Zeitungen erschienen sind und wo ein Jagd- und Naturschriftsteller vom Format eines Otto Alscher bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gelebt hat.
Eine tausend Jahre alte Serbensiedlung
Die Ortschaft Svini]a hat heute um die 1000 Einwohner und ist eine Gründung serbischer Migranten von südlich der Donau – damals emigriert aus dem byzantinischen Reich in ein Banat unter mehrmals wechselnder Herrschaft – im Rahmen einer der vielen Migrationsströmungen von Serben in Räume der nördlich des Donaulaufs gelegenen Gebiete.
Svini]a ist, laut dokumentarischen und archäologischen Zeugnissen, im XI. Jahrhundert von Serben besiedelt worden, zwischen den Jahren 1030 und1040. Aus dem serbisch geprägten Mittelalter dieses Raums stammen auch die aus dem Donaustausee noch herausragenden Ruinen der Festung Tricule aus dem XI.-XIV. Jahrhundert (allerdings stehen heute nur noch zwei der drei ehemals in einem kleinen Dreieck angeordneten „Kule“, ehemals Wachtturm-Ruinen aus Felsbruchstein. Denn die vielbesungenen Donauwellen haben bei den hier heftig agierenden Sturmwinden – von den Einheimischen „Co{ava” oder auch „Gorniak” genannt, der Donaudurchbruch beim Eisernen Tor wirkt auch wie ein Windbeschleuniger, wenn die klimatischen Bedingungen dazu günstig sind – den dritten zum Einsturz gebracht – sämtliche Warnungen und Hilferufe zur Konservierung, ausgestoßen von Historikern und Archäologen, sind ohne Echo verhallt!
Doch Spuren menschlicher Anwesenheit sind hier viel älter (und auch abgesehen von den vielen, zur Zeit des Ceau{escu-Nationalkommusmus während der Rettungsgrabungen vor der Überflutung durch den Donaustausee entdeckten Dakerspuren...), denn indirekte Zeugnisse machen die Vermutung plausibel, dass der Raum des heutigen Svini]a in engstem Zusammenhang stand mit der bis heute nachweisbar ältesten Kultur Europas (und der Welt, denn Ähnliches hat man bisher nur in der Harappa-Kultur und der weltweit größten bekannten bronzezeitlichen Siedlung der Menschheit in Mohenjo Daro – auch Mohanjo-Daro oder Moenjo-Daro, was im modernen Sindhi „Ort/Hügel der Toten” bedeutet – im unteren Indus-Tal entdeckt...) – die Rede ist von der Lepenski-Vir-Kultur vom genau gegenüberliegenden, heute serbischen Donauufer.
Lepenski Vir und Schela Cladovei
Die einzigartigen „Hausgötzen“ der Lepenski-Vir-Kultur aus riesigen, vom Donauwasser sinnlich rundgeschliffenen Flusskieseln, denen nachmalig von Menschenhand „Gesichtsform“ mit Glupschaugen (oder „Fischaugen“) und Schmollmund (oder „Fischmaul“) herausgemeißelt wurden, die Bauweise der Hütten – alle mit Hausgötzen an der Herdstelle, mit trapezförmigem Grundriss, wo die Breitseite des Trapezes ans jenseitige Donauufer weist, wie ausgebreitete Arme – auf jenem Berg hinter der heutigen Gemeinde Svini]a (die Ortsbezeichnung bedeutet im Serbischen „Schweineplatz” oder „Schweinchen”), ein die Gegend dominierender Berg, der genausolche trapezförmigen Konturen in den Himmel zeichnet (weswegen vermutet wird, dass er der Götzenberg der Bewohner von Lepenski Vir war), all das verleiht dem Raum dieses Abschnitts des Donauengpasses etwas Mythisches, Geheimnisvolles, ebenso wie die heute noch zirkulierenden Legenden über Riesen, die hier einmal gelebt haben sollen und von denen doch tatsächlich Skelette im Museum von Turnu Severin aufbewahrt werden.
Während die Lepenski-Vir-Kultur vom rechten Donauufer sich auf einem weit in die Donau hineinstreckenden Felsvorsprung mit vorurbanen Charakteristika – etwa eine Art Wasserversorgungssystem mit Abwasserleitung – entwickelt hat, handelt es sich am linken Ufer der Donau um die Schela-Cladovei-Kultur, die (manche Forscher meinen: forciert) in der rumänischen Forschung meist als „Schela-Cladovei/Lepenski Vir”-Kultur bezeichnet wird. Ihre Hauptfunde stammen vom Nord- und (teilweise) Südrand des heutigen Drobeta Turnu-Severin, Schela Cladovei liegt am nördlichen Rand der Stadt. Dort wird seit den 1960er Jahren gegraben. Der Felsvorsprung von Lepenski Vir liegt heute (durchschnittlich 12 Meter) unterm Spiegel des Donaustausees. Grabungen sind hier nur noch durch Unterwasserarchäologie möglich, unseres Wissen werden aktuell keine unternommen. Hingegen tingeln die Serben seit Jahrzehnten mit einer Lepenski-Vir-Ausstellung um die Welt.
Karbondatierungen der Funde vom rumänischen Ufer weisen auf eine Zeit um das Jahr 8750 vor Christus hin, sagen die Archäologen von Turnu Severin, die mit dem Bukarester Archäologischen Institut gemeinsam Untersuchungen anstellen. Fakt ist, dass die Skelettfunde, die man am rumänischen Ufer machte – vom serbischen Ufer sind keine Skelettfunde bekannt – auf ungewöhnlich hochgewachsene Menschen hinweisen. Kein Skelett ist unter 1,90 Meter groß. Das führen Forscher auf eine Ernährungsweise zurück, die sich hauptsächlich auf rohen Fisch und rohes Gemüse gestützt haben soll. Wohl von diesen übergroßen Skeletten ausgehend stammen die heute noch existierenden Legenden von den Riesen, die aller Wahrscheinlichkeit nach reale Grundlagen haben. Ein solches Skelett war zur Zeit unseres letzten Besuchs im 1912 gegründeten Museum der Region des Eisernen Tors/ Muzeul Regiunii Por]ilor de Fier in Drobeta-Turnu Severin ausgestellt gewesen.
Kreativität im Feigendorf im Donaudurchbruch
Doch zurück in die Gegenwart und nach Svini]a, das Feigendorf des Südbanats. Dort findet alljährlich am letzten August-Wochenende das „Festival der Feigen” statt. Denn dort gibt es kein Haus, wo nicht wenigstens ein paar Feigenbäume wachsen. Inzwischen gibt es aber auch schon mehrere Feigenplantagen – Initiativen von vor allem jungen Farmern oder Ehepaaren, die sich auf Feigenproduktion und die Verwertung der Früchte spezialisiert haben. Statistiken besagen, dass Rumänien jährlich um die 500-550 Tonnen Feigen produziert, hauptsächlich in den bisher dafür klimatisch und pädologisch günstigen Gegenden – vor allem in der Dobrudscha und dem Donauengpass mit seinen submediterranen Klimainseln. Immer größere Mengen dieser Jahresproduktion kommen aus Svinița.
Allerdings reisst man sich in Svini]a nicht unbedingt um den Verkauf frischer Früchte, sondern hat sich eher auf Veredelung der hochwertigen Früchte spezialisiert. Konservierung durch Trocknen ist immer noch das Einfachste und Üblichste. Es soll aber bereits in der Ortschaft mindestens 200 Häuser geben, in denen Feigenmarmelade und Feigenkonfitüre (in der Art der südrumänischen supersüßen „dulceață” – durchwegs von türkischem Vorbild und Einfluss) produziert werden. Und in fast genau so vielen privaten Kupferkesseln wird in Svini]a eine Vielfalt von scharf-aromatischem Feigenschnaps produziert. Der nicht selten duch Einlegen von frischen Feigen zu Feigenlikör veredelt wird. Feigenwein, süß und schwer, wie man ihn stellenweise vor Zeiten auch im Banat produziert hat (dem Autor war in den 1970er Jahren ein Haus in Großkomlosch bekannt, wo es diesen schweren Feigenwein zum Kosten gab…), wird in Svini]a selten produziert. Aber auch der fehlt nicht gänzlich im Angebot.
Die Feige, eine der ältesten Nutzpflanzen
Denn beim „Festival der Feigen” von Svini]a gibt es praktisch alles, was man aus Feigen (Ficus carica) machen kann. Denn man hat hier früh den Wert dieses dankbaren und reich, mindestens zweimal im Jahr, früchtespendenden Baumstrauchs zu schätzen gelernt. Auch kulinarisch. Die örtlichen Rumäninnen und vor allem die Serbinnen nutzen Feigen zu fast allem, was man so als Hausfrau an Köstlichkeiten auf den Tisch stellen kann, vom Braten bis zum Kuchen und allerlei Getränken.
Dass die Frucht des Feigenbaums (und nicht nur sein Blatt…) höchstgeschraubten Ansprüchen bezüglich Nahrungswert entspricht, ist den Bewohnern von Svinița instinktiv bekannt geworden, seit vor rund 350 Jahren – so die Ortslegende – ein türkischer Pascha von der heute versunkenen Donauinsel und –festung Ada Kaleh (sie lag etwa 20 Kilometer donauabwärts, heute auf dem Grund des Donaustausees beim Eisernen Tor I) nach Svinița (ausdrücklich gegen seinen Willen) versetzt wurde und seinen ganzen Harem ausnahmslos auf Ada Kaleh zurückließ, aber mit einem Bündel junger Feigenbaumsetzlinge in der Bucht von Svinița an Land ging – den Ursprungspflanzen der heutigen Feigenbaumplantagen von Svinița.
Feigen haben neben ihrem unverwechselbaren Geschmack einen außerordentlich hohen Nährwert, nicht nur wegen ihres einzigartigen Gemischs von Naturzucker - Fruktose und Glukose – und der dadurch bedingten, weil unmittelbar ins Blut übergehenden und augenblicklich wirkenden Stärkung und Wiederbelebung des Organismus beim Genuss von Roh-, Trocken- oder unterschiedlichst eingemachten Feigen. Deswegen gelten sie unter Sportlern und unter chronischer Müdigkeit Leidenden als Geheimtipp. Zudem gibt es kaum etwas besseres als Feigen bei der „Wiederbelebung” des Verdauungstrakts, etwa bei Verstopfung… Und sie halten den Verdauungstrakt gesund, weil sie reich an Faserstoffen sind. Feigen stecken voller Vitamine und Minerale: Kalium, unerlässlich für Herz, Kreislauf und Blutdruck, Kalzium für die Knochen, Magnesium für die Muskeln, Eisen für alles, aber auch die Vitamine der Gruppen A, E, K und B. Feigen enthalten Antioxidanzien und bremsen damit den Alterungsprozeß durch Abwehr freier Radikale, beugen Krankheiten vor. Nicht zuletzt: Feigen enthalten kaum Fette, kein Cholesterin, sind also faktisch jedem ausgewogenen Ernährungsplan mühelos beifügbar oder komplementär. Zudem: ihre Glukose und Fruktose verleihen ziemlich rasch ein angenehmes Sattheitsgefühl, nie ein Völlegefühl. Ergo: mit Feigen vermeidet man leicht die im Mittelalter als schweres Laster betrachtete Völlerei…In Svinița heißt es: nur ausgeglichene Menschen haben ums Haus Feigenbäume… Lies: in Svinița leben lauter ausgeglichene Menschen…
Und das will ja, bei den im Banat als heißblütig und leicht reizbar verschrieenen Serben (aber auch bei vielen Rumänen…), allerhand heißen.