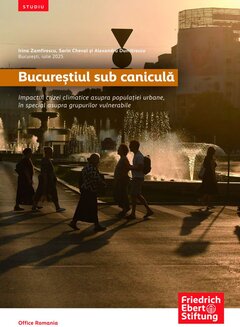Die Zahlen der heißen Tage sowie die der tropischen Nächte in Bukarest befinden sich im Steigen. Eine aktuelle Studie der Weltbank sagt für Bukarest einen massiven Anstieg der mit Extremtemperaturen verbundenen Todesfälle voraus. Doch genau wie die Hitze nicht überall in der Stadt gleich stark auftritt – dort, wo Grünflächen oder Gewässer sind, ist sie deutlich schwächer – betrifft sie manche Menschen mehr als andere. Die einen stöhnen unter der Hitze, die anderen sterben daran. Junge, mobile und gut verdienende Menschen können sich ihr besser entziehen als alte, arme und kranke. Eine neue Untersuchung der Friedrich-Ebert-Stiftung Rumänien stellt genau diese „vulnerablen“ Gruppen in den Fokus.
Die vorliegende Studie „Bukarest unter Hitze. Auswirkungen der Klimakrise auf die städtische Bevölkerung und insbesondere vulnerable Gruppen“, erstellt von der Soziologin Irina Zamfirescu und den Klimawissenschaftlern Sorin Cheval und Alexandru Dumitrescu, beschreibt zunächst die klimatischen Veränderungen in Bukarest, ohne auf die Ursachen, den menschengemachten Klimawandel, näher einzugehen. Die Autoren zeigen jedoch auf, wie städtebauliche Maßnahmen die lokalen Temperaturen weiter in die Höhe treiben.
Kurz zusammengefasst: Oberflächen, die bebaut bzw. durch verschiedene Materialien versiegelt werden, speichern die Wärme deutlich stärker. Die menschliche Nutzung dieser Flächen produziert zudem weitere Wärme – motorisierter Verkehr, Klimaanlagen etc. Flächen mit natürlicher Vegetation haben dagegen einen Kühlungseffekt aufgrund der sogenannten Evapotranspiration von Pflanzen und des Schattens, den diese spenden.
Wegen der starken Versiegelung Bukarests, mehr als 50 % der Oberfläche ist laut Autoren „menschlich modifiziert durch Bauten, Straßen, Industriegebiete und anderweitige Gestaltung“, können in der Hauptstadt die Temperaturen bis zu 5-6 Grad Celsius höher sein als in ihrem Umland („urbane Wärmeinsel“). Gleichzeitig zeigen Messungen innerhalb der Stadt, dass die Temperaturen in Parks und an Seen deutlich niedriger sind, sie stellen sozusagen lokale Kühlungspunkte dar und nehmen eine entscheidende, mildernde Rolle in Bezug auf das städtische Gesamtklima ein. Daher stehen sie auch im Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn es um die Frage der städtischen Gestaltungsmöglichkeiten geht.
Weniger Luftverschmutzung, besseres Klima
In einem weiteren Kapitel gehen die Autoren der Frage nach, wie die Stadt Bukarest und ihre Verwaltungen auf die Hitze und die damit verbundene Gefahr für die Gesundheit reagieren. In den verschiedenen Strategiepapieren der Stadtverwaltung – die Autoren weisen in diesem Zusammenhang auf die „lange Geschichte (Bukarests) an strategischen Dokumenten, die nur teilweise umgesetzt wurden,“ hin – identifizieren die Autoren zwei Stränge an (geplanten) Maßnahmen, die mit dem Thema Hitze zu tun haben. Ersterer lässt sich unter dem Stichwort „Luftverschmutzung“ zusammenfassen, welche vor allem durch den motorisierten Verkehr und bestimmte Heizformen verursacht wird (die ADZ berichtete).
Strategien der Stadt zielen diesbezüglich auf einen Ausbau, eine Modernisierung des öffentlichen Nahverkehrs bzw. eine Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden und Erneuerung der Heizsysteme ab. Jenseits der Pläne und einiger bereits angelaufener Maßnahmen (z. B. Anschaffung moderner E-Busse und neuer Straßenbahnen für den Linienverkehr) bleibt die Feststellung: „Bukarest ist die einzige europäische Hauptstadt, die keine Maßnahmen zur Entmutigung der Durchquerung des Zentrums mit dem Auto hat.“ Mehr noch: Über die Jahre hätten politische Entscheidungen in Bukarest vielfach den Autoverkehr priorisiert und damit zum Temperaturanstieg beigetragen.
Echte Grünflächen beugen Hitze vor
Der zweite Strang hat mit dem Aus- bzw. Umbau von Grünflächen im Stadtgebiet zu tun. Auch hier stellen die Autoren der Verwaltung ein schlechtes Zeugnis aus. Auf Ebene der übergeordneten Stadtverwaltung (PMB – Primăria Municipiului București) bestehe aktuell „ein schwaches Interesse in Bezug auf Grünflächen“. Die Verwaltungen hätten in der Vergangenheit das Thema lediglich unter dem Aspekt der Freizeitgestaltung betrachtet, nicht aber als Klimafrage. Anders gesagt, wo naturbelassene Parks notwendig wären, wurden asphaltierte Wege und Spielplätze mit Tartanboden gebaut. In dieses Bild passt der Umgang mit dem sogen. Grünflächenregister, welches seit 2007 gesetzlich vorgeschrieben ist, 2011 auch errichtet, aber in der Folge nie im Stadtrat verabschiedet wurde und daher keine rechtliche Verbindlichkeit erlangt hat, de facto also nicht vorhanden sei.
Allgemein bescheinigen die Autoren der Stadt Bukarest eine „unzureichende institutionelle Resilienz“ gegenüber dem Klimawandel, was letztlich bedeutet, dass die Stadtverwaltung nicht in der Lage ist, wirksame Politiken zur Abmilderung des Temperaturanstiegs bzw. seiner Auswirkungen umzusetzen. Es fehlen Strukturen innerhalb der Behörden, welche den Klimawandel auch als soziale und gesundheitsrelevante Frage ansehen und entsprechende Antworten erarbeiten. Zudem hemme die Aufteilung der Kompetenzen zwischen PMB und den Rathäusern der sechs Sektoren die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen für ein Phänomen, das nicht an Verwaltungsgrenzen halt macht.
Die Studie sieht aber auch Hoffnungsschimmer. Unter dem Druck von zivilgesellschaftlichen Initiativen und NGOs, aber auch der EU, sowie unter dem Eindruck der immer stärker sichtbaren Folgen des Klimawandels, habe in letzter Zeit ein Umdenken in den verantwortlichen Stellen eingesetzt. Seit diesem Jahr habe die Stadt immerhin einen Verantwortlichen für Klimaneutralität benannt.
Akutmaßnahmen bei extremer Hitze kaum vorhanden
Von den mittel- bis langfristigen städtischen Maßnahmen zur Abmilderung des Klimawandels einmal abgesehen, stellt sich die Frage nach möglichen Sofortmaßnahmen an Tagen mit extremen Temperaturen. Schließlich wird selbst per RO-Alert bei „cod roșu“ (einen klaren Grenzwert, ab wann diese höchste Warnstufe bei Hitze ausgerufen wird, gibt es nicht, aber irgendwo zwischen 37 – 40 Grad im Schatten ist dieser in der Regel erreicht) vor der Gesundheitsgefahr durch Hitze gewarnt.
Die Autoren der Studie haben diesbezüglich Anfragen an PMB und die Bürgermeisterämter der Sektoren gestellt. Die Antworten fielen spärlich aus, PMB und Sektor 1 antworteten gar nicht, die Sektoren 3 und 4 mehr oder weniger substanzlos. Die anderen Verwaltungen verweisen auf öffentliche Anlaufstellen, in denen Menschen sich abkühlen, Trinkwasser und medizinische Unterstützung erhalten können sowie auf die vorhandenen Trinkwasserspender im öffentlichen Raum. Lediglich Sektor 6 spricht von Versuchen, gezielt obdachlose Menschen mit Wasser zu versorgen und in Unterkünfte zu verweisen.
Die Antworten machen klar, dass die Bemühungen der städtischen Behörden bisher allenfalls rudimentär sind und lenken die Aufmerksamkeit auf die Personengruppen, die am stärksten unter der Hitze leiden: Obdachlose, bzw. Menschen in informellen Wohnsettings (ohne Wasser- und Stromversorgung), Ältere, Kranke und solche, die trotz extremer Temperaturen ihre Arbeit im Freien oder nicht gekühlten Räumlichkeiten erledigen müssen.
Hitze ohne Möglichkeit der Abkühlung
In der Studie schließt sich eine qualitative Untersuchung einiger besonders vulnerabler Gruppen und deren Empfinden bzw. Umgang mit der Hitze an. Dazu führten die Autoren Interviews mit Menschen, die auf der Straße leben, solchen, die in verlassenen Häusern wohnen und mit Personen, die als Essenslieferanten oder Bauarbeiter der Hitze ausgeliefert sind.
Ihre Erzählungen verdeutlichen, dass die Hitze viele Probleme, mit denen sie sich jeden Tag auseinandersetzen müssen, verstärkt und machen klar, wie sie zu einer existenziellen Bedrohung werden kann: Der gesteigerte Bedarf an Wasser zum Trinken oder Waschen, Lebensmittel, die häufiger und in kleineren Mengen gekauft werden müssen, weil sie sonst verderben und damit teurer werden; Abkühlung finden diese Personen ohne Klimaanlage und Kühlschrank zuhause nur in Malls, bis sie dort von der Security vertrieben werden. Menschen in prekären Jobs trauen sich trotz gesundheitlicher Einschränkungen und akuter Gefahr bei Extremtemperaturen nicht, von der Arbeit fernzubleiben, weil sie auf das Einkommen angewiesen sind.
Darüber hinaus drohen bestimmten besonders hitzegefährdeten Personengruppen paradoxerweise weitere Nachteile durch mögliche Maßnahmen zur Begrünung der Stadt. Wie die Autoren herausarbeiten, könnten Orte an denen Menschen derzeit informell oder zu sehr geringen Mieten wohnen, durch das Anlegen neuer Grünflächen bzw. die daraus resultierende Aufwertung der Nachbarschaft für diese unbewohnbar werden. Sie müssten dann an andere, weniger zentrale Orte ausweichen. Das nennt man Gentrifizierung.
Mehr grün, weniger Lebensraum für Arme?
Die Autoren weisen darauf hin, dass dieses Problem, dem man als Stadt aktiv entgegenwirken müsste, um es zu verhindern, von eben dieser bisher kaum erkannt sei, die betroffenen Gruppen in der Diskussion nicht berücksichtigt würden. „Die Verbesserung der Qualität öffentlicher Räume ist ein Vorhaben, das die Behörden angehen müssen, aber auf kontrollierte Art und Weise, so dass vulnerable Gruppen geschützt werden vor einer möglichen Verschlechterung der Situation, in der sie sich befinden, und sichergestellt wird, dass alle Bürger, unabhängig von Einkommen und Ethnie, von der grünen Infrastruktur profitieren.“
Es ist, wie die Autoren schreiben, zweifellos eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Denn ähnlich wie auf globaler Ebene, sind diejenigen, die individuell am wenigsten zum Temperaturanstieg beitragen – kein Auto mit voll aufgedrehter Klimaanlage durch die Innenstadt fahren –, gleichzeitig am stärksten davon betroffen. Sie haben weder die Ausstattung noch die finanziellen Mittel, um Ausweichstrategien, etwa eine Shoppingtour durch die klimatisierte Mall, umzusetzen. Notwendig wäre also eine Klima-Politik, die zunächst die Bedarfe dieser Gruppen in den Blick nimmt und sie nicht durch sozial unausgewogene Anpassungsmaßnahmen ein weiteres Mal benachteiligt.
Die Studie schließt mit der Auflistung einiger Empfehlungen an die Politik, welche von institutionellen Veränderungen in den Verwaltungen, über neue strategische Ansätze bezüglich der Gestaltung von Grünflächen und öffentlicher Infrastruktur, z. B. Bushaltestellen, Gehwege und Spielplätze, bis zu konkreten Einzelmaßnahmen, wie die Ausweitung des Netzes öffentlicher Trinkwasserspender und besseren Zugang zu öffentlichen Brunnen, reichen. Bereits vorher wird im Text auf Best-Practice-Modelle anderer Großstädte verwiesen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Stadt Bukarest, auf allen beteiligten Ebenen, davon inspirieren lässt und die Lösungsansätze nicht nur in schön gestalteten Strategiepapieren versenkt werden. Der nächste Hitzesommer steht vor der Tür.