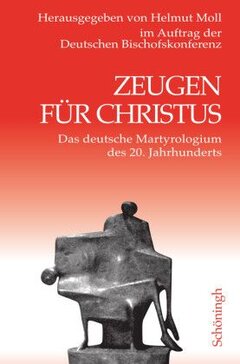Die zahlreichen aktuellen Kriege, Konflikte, Verfolgungen – bekannt und propagiert oder ungenannt, unpopulär und vergessen – immer auch runterzubrechen auf den einzelnen ausgelöschten Menschen birgt jenseits des Aufrufs, Friedensmut und -Hoffnung dazugegenzusetzen, das Gehen ans Eingemachte – wofür lohnt es sich zu leben? Noch mehr: wofür lohnt es sich zu sterben? Noch mehr: (Wie) kann ich dafür sterben? Vor diesem Hintergrund einen weiteren Verweis auf das zweibändige Werk „Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts“ zu bekommen (die ADZ schrieb darüber auch 2021) ist berührend und auch provokativ angesichts dessen, dass es in der Ausrichtung des Werkes liegt, über einen bestimmten Opferkreis von Gewalt zu sprechen.
Das 20. Jahrhundert hatte als Folge von Nationalsozialismus, Kommunismus und vielen Kämpfen unzählige Märtyrer hervorgebracht. Ein Märtyrer sagt uns heute mehr als nur etwas über die Vergangenheit – er stellt uns eine radikale, unbequeme, aber kraftvolle Frage: Wofür bin ich bereit zu leben – oder sogar zu sterben? Ein Märtyrer zeigt, dass der Glaube nicht bloß Tradition oder Kultur ist, sondern eine existenzielle Wahrheit, die das ganze Leben umfasst.
Diese Frauen und Männer, die für ihren Glauben litten und starben, nicht zu vergessen, war ein Anliegen von Papst Johannes Paul II. Das geistliche Oberhaupt der weltweiten katholischen Kirche rief 1994 in seinem Apostolischen Schreiben Tertio millenio adveniente (Nr. 37) die Ortskirchen auf, dafür zu sorgen, dass die Zeugnisse derjenigen nicht verloren gingen, die in den Verfolgungen des 20. Jahrhunderts an ihrem Glauben festgehalten und dafür ihren Tod in Kauf genommen hatten.
Auszeichnung für Lebenswerk von Prälat Moll
Die Deutsche Bischofskonferenz betraute hiermit Prälat Prof. Dr. Helmut Moll, lange Jahre auch Beauftragter für Selig- und Heiligsprechungsverfahren im Erzbistum Köln. Unter Einbindung von Diözesanbeauftragten und Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter entstand das zweibändige Hauptwerk mit dem Titel „Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts“, das in erster Auflage bereits 1999 vorgelegt werden konnte und sich als Teil des Gesamtprojekts der Märtyrergeschichte des 20. Jahrhunderts versteht. Das Werk wurde laufend ergänzt und hatte innerhalb kürzester Zeit, bis 2015, bereits die sechste Auflage erreicht.
Am 22. November 2008 zeichnete die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte mit Sitz in Frankfurt am Main das Werk mit dem Stephanus-Preis aus und Prälat Moll wurde am 20. Juli 2017 für sein Lebenswerk der August-Benninghaus-Preis in Ankum (Landkreis Osna-brück) verliehen, in Anerkennung seiner Verdienste erhält er 2023 anlässlich seines 80. Geburtstages die neue Geschenkplakette der Deutschen Bischofskonferenz.
Über die 7. Auflage (erschienen 2019) berichtete die ADZ bereits. Doch seit der 7. Auflage ging die Arbeit unermüdlich weiter und Prälat Moll förderte immer neue Lebensbilder zutage, die für ergreifende Zeugnisse stehen.
So konnte 2024 die 8., erweiterte und aktualisierte Auflage erscheinen, die mehr als 1000 Lebensbeschreibungen enthält, die in vier Kategorien vorgestellt werden: Gewaltopfer des Nationalsozialismus, des Kommunismus, der Reinheitsmartyrien und Gewaltopfer in den Missionsgebieten (siehe auch www.deutsches-martyrologium.de).
Märtyrer unter den Donauschwaben
Das Werk als deutsches Martyrologium umfasst ausschließlich deutsche Christinnen und Christen. Das bedeutet auch Deutsche in Gebieten außerhalb Deutschlands. So ist ebenso Südosteuropa leidvoll vertreten. Das Kapitel „Donau-schwaben“ präsentiert Angehörige aus dieser Gruppe von Deutschen, die seit dem Ende des Ersten Weltkrieges auf Ungarn, Rumänien und Jugoslawien aufgeteilt waren. Viele von ihnen waren gegen das Ende des Zweiten Weltkrieges den Truppen der Sowjetunion und ihrer Verbündeten schutzlos ausgeliefert, erlitten Plünderungen und Vergewaltigungen, wurden zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppt, wo ein Teil von ihnen in den Arbeits- und Todeslagern starben, oder sie wurden in ihrer Heimat als politisch unzuverlässige Elemente erschossen.
Das Kapitel folgt der Unterteilung in Östliches Banat, Banat, Batschka, Baranya-Syrmien-Slawonien-Kroatien, Bosnien und ein Unterkapitel ist den Trappisten in Bosnien und Herzegowina gewidmet, die zu Blutzeugen wurden und einer Märtyrerin aus dem Laienstand, einer Hausfrau und Mutter aus Filipova/Batschka.
Für den Donauschwäbischen Raum werden an die 50 Zeugen vorgestellt.
Dies mag wenig erscheinen angesichts dessen, dass von Oktober 1944 bis Juni 1945 durch Rachemorde und Säuberungsaktionen 9500 donauschwäbische Männer und Frauen sowie zwischen Dezember 1944 und März 1948 51.000 donauschwäbische Kinder, Frauen und betagte Personen in den Vernichtungslagern ums Leben kamen. Aber Dokumente und mündliche Zeugnisse, die für diese Zeit Martyrien ausweisen würden, sind nicht leicht zu finden, und ist es schwierig, aus den Berichten der Augenzeugen die kirchlichen Kriterien, die ein Martyrium kennzeichnen, eindeutig herzuleiten.
Im Abschnitt zum östlichen Banat finden wir den Seligen Bischof Dr. Johann Scheffler, Erzdechant Johann Kräuter und Pater Paulus Weinschrott, die nach jahrelanger Haft im Gefängnis starben; Bischof Augustin Pacha wurde als todkranker Mann entlassen, um bald darauf (November 1954) zu sterben. Es werden nicht nur die zum Teil grotesken Anschuldigungen beschrieben, die zur Inhaftierung führten, und die menschenunwürdigen Haftbedingungen, sondern auch die Konsequenz, mit der selbst den Toten der Respekt versagt wurde (Bischof Scheffler fand sein Grab auf dem Gefängnisfriedhof von Jilava, eingewickelt in einen Papiersack).
81 neue Namen, darunter Pfarrer Michael Kurth
Da es sich um ein deutsches und katholisches Martyrologium handelt, fehlen naturgemäß die Angehörigen anderer Völker, ebenso wie z.B. evangelische Opfer aus Siebenbürgen, wodurch mancher Abschnitt zu Südosteuropa zu schmal zu sein scheint. Um hier vergleichen zu können, müssen, sofern vorhanden, die anderen Martyrologien herangezogen werden. Erwähnt sei, dass auf Begegnungen mit Prälat Moll in Temeswar und Suceava hin das Martyrologium „Martiri pentru Hristos din Romania in perioada regimului comunist“ (Bukarest 2007, ISBN: 978-973-616-092-9) erstellt wurde, das methodisch auf dem deutschen Martyrologium aufbaut und 2017 eine Wiederauflage erfahren hat.
Neu hinzu kamen nach der 7. Auflage 81 Namen, darunter die des Märtyrerpriesters Michael Kurth (1901 – 1944), eines Priesters der Diözese Temeswar, zu dessen ausführlicherer Biografie auch auf den Artikel von Prälat Moll in der Monatszeitschrift für die Katholische Kirche im Deutschen Sprachraum Kirche heute Nr. 10/Oktober 2021 verwiesen sei und der hier vorgestellt werden soll. Michael Kurth wurde am 16. Februar 1901 in Walkan/Valcani als Sohn banatschwäbischer Eltern geboren und in Altbeschenowa/Dude{tii Vechi (damals Be{enova Veche) getauft. Er besuchte das Piaristengymnasium in Temeswar, das er 1921 mit dem Bakkalaureatsdiplom abschloss. Nach Studium der Philosophie und Theologie in der Theologischen Akademie von Temeswar wurde er 1925 (mit Dispens wegen noch nicht erreichten Mindestalters) in der Kathedrale von Großwardein/Oradea zum Priester geweiht. Es folgen erste Jahre seelsorgerlicher Erfahrung als Kaplan in Bakowa, dann Winga und Altbeschenova. Am 1. Mai 1930 wurde er zum Kaplan an der Pfarrkirche Hl. Johannes von Nepomuk in Glogowatz ernannt. 1931 bis 1934 wirkte er in Reschitza als Kaplan und Religionslehrer am dortigen Knabengymnasium, am 1. Oktober 1934 übernimmt er als Pfarradministrator die Pfarrei Clocotici im Banater Bergland. Diözesanbischof Dr. h.c. Augustin Pacha von Temeswar beruft Kurth am 19. April 1940 nach Altbeschenowa, zunächst als Pfarrverweser, am 12. Oktober 1942 folgt die Ernennung zum Pfarrer.
Schon bald nach dem Umsturz vom 23. August 1944 wurde das Banat zum Kriegsschauplatz. Kurth mit seinen Kaplänen beerdigte Opfer der Kriegshandlungen kirchlich, darunter waren auch ein deutscher Soldat und mehrere Einwohner, die von sowjetischen Soldaten getötet worden waren. In den Augen seiner Gegner hatte er sich damit schuldig gemacht. Diese Toten zu begraben, die von der Roten Armee getötet worden waren, noch dazu als Deutscher, wurde als Vergehen betrachtet. Kurth wurde zur sowjetischen Kommandatur nach Großsanktnikolaus gebracht, das Auto kam nach einer halben Stunde ohne Kurth zurück. Am nächsten Tag, dem 11. Oktober 1944 fanden seine Angehörigen seinen Leichnam drei Kilometer vom Dorf entfernt. Sie beerdigten ihn am 13. Oktober 1944. Zugegen waren nur seine Eltern, sein Bruder, seine Schwestern und Schwager bzw. Schwägerin, kein Priester. „Zu einem späteren Zeitpunkt erzählten die russischen Soldaten, was sich zugetragen hatte. Kurth sei zu der Stelle seines Todes gebracht worden, wo er, ahnend, was ihn erwartete, die Soldaten gebeten hatte, sich einige Minuten im Gebet sammeln und besinnen zu dürfen. Er nahm den Tod als Martyrium im Gebet an. Nachdem die Zeit der Besinnung vorbei war, habe Kurth den Soldaten gesagt, er sei zu sterben bereit. Daraufhin wurde er durch einen Kopfschuss getötet.” (Helmut Moll, Monatszeitschrift für die Katholische Kirche im Deutschen Sprachraum Kirche heute Nr. 10/Oktober 2021, S. 22)
Gegen das Vergessen
Es bleibt, Prälat Moll und seinen Mitarbeitern Dank auszusprechen für dieses beachtliche Werk, nicht nur u.a. hinsichtlich der wissenschaftlichen Genauigkeit und sorgfältigen Recherche, die detaillierten Inhaltsverzeichnisse, die theologische Einführung. Mögen die Bände gute Verbreitung finden, um die Zeugen ans Licht zu heben und bewusst und zugänglich zu machen – gegen das Vergessen. Die beiden Bände bezeugen zwar mit jeder Bio-grafie die Grausamkeit, zu der Regime und Menschen fähig sind, aber auch die Hoffnung aus der Treue, mit der Menschen ihrem Ideal verbunden blieben. Der Märtyrer ruft zur Klarheit, Unterscheidung und Konsequenz auf. Wofür stehe ich? Woran glaube ich wirklich – wenn es darauf ankommt? Und er ruft uns zur Versöhnung – weil er für eine Wahrheit gestorben ist, die größer ist als alle Spaltungen.
„Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts“, hrsg. von Helmut Moll im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, 8., erweiterte und aktualisierte Auflage 2024, Brill I Schöningh ISBN 978-3-506-79130-6, zwei Bände, 99 Euro, erhältlich im Buchhandel oder unter brill.com.
Der Herausgeber
Prälat Prof. Dr. Helmut Moll, Studium der Kath. Theologie und Geschichte, Promotion 1973 bei Prof. Dr. Joseph Ratzinger in Regensburg. Priesterweihe 1976, 1984-1995 im Dienst der Römischen Kurie. 1998 – 2017 Beauftragter für Selig- und Heiligsprechungsverfahren im Erzbistum Köln, weiterhin begleitet er als Vizepostulator den Seligsprechungsprozess von Friedrich Joseph Haass. Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für das Martyrologium des 20. Jh.
Weitere Beiträge v. H. Moll zum Thema
„Die katholischen deutschen Martyrer des 20. Jahrhunderts. Ein Verzeichnis“ (Paderborn u. a. 1999; 4. Auflage 2005, 83 S.) ist ein Einführungsbuch, das alle Banater Glaubenszeugen namentlich aufführt. Es enthält in tabellarischer Form Kurzdaten zu über 700 Glaubenszeugen, ein Porträtfoto der mit einer Kanonisation Verbundenen sowie ein ausführliches Personen- und Ortsregister.
Eine Rezeptionsgeschichte des Martyrologiums bietet die Bilanz „Martyrium und Wahrheit. Zeugen Christi im 20. Jahrhundert” (Weilheim 2005, 7. Auflage 2020; 13,50 EUR
Das Kalendarium „ZEUGEN FÜR CHRISTUS“. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, hrsg. im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz (2024), versteht sich als Handreichung zum Deutschen Martyrologium, umfasst 161 Seiten im handlichen DIN-A5-Format und ordnet die Glaubenszeugen nach ihrem Todesdatum. Das Kalendarium hilft im täglichen Gebrauch der Märtyrer zu gedenken Zu beziehen über die Arbeitsstelle für das deutsche Martyrologium (50068 Köln, Kunibertsklostergasse 3), 12 EUR.