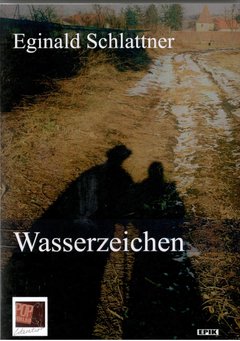Nach eigenen Aussagen Schlattners sollte mit „Wasserzeichen“ ein Schlusspunkt seines schriftstellerischen Werkes gesetzt werden. Der 1933 geborene Autor lebt heute auf seinem Pfarrhof in Rothberg/Roșia – eine einst sächsische Gemeinde nahe von Hermannstadt, in deren Kirche nun Zigeunerkinder das Weihnachtsspiel aufführen. Mit der Beschreibung dieser für viele seiner evangelischen Landsleute nicht leicht zu akzeptierenden Sachlage endet das Buch. Und mit dem erneut bekräftigten, ebenso schockierenden Wunsch Schlattners, wenn es so weit ist, „das Zeitliche zu segnen, den Geist aufzugeben im Kreise frommer Frauen an gottdurchlässiger Stelle.“
„Wasserzeichen“ ist zwischen 2006 und 2017 am Rothberger Pfarrhof und in einem orthodoxen Nonnenkloster geschrieben, in das sich Schlattner zurückgezogen hatte und wo er als Gast die Zeit und Muße fand, seinen Erinnerungen freien Lauf zu lassen und auf Papier zu bringen.
Das Buch, das eher in weiterem Sinn als Roman bezeichnet werden kann, trägt die denkbar einfachste Widmung: „MIR“. Wenn eine Widmung, dann nur „MIR“ - so hatte Schlattner es beschlossen. Die über 600 Seiten sind, kann man schlussfolgern, geschrieben, „um sich in die Tiefen und Untiefen der Erinnerung“ zu versenken. Es handelt sich nicht um eine Abrechnung oder um einen Versuch der Versöhnung. Es ist die persönliche Sicht auf Etappen des eigenen Lebens; es ist die Schilderung von Menschen, die ihm nahe standen, die ihm wichtig waren mit allen damit verbundenen Gefühlen: von Freude und Schmerz, von Verbindendem und Trennendem, von Hoffnung und Angst. Dabei taucht der Leser in eine heute den meisten unbekannte, aber nicht fremde Welt. Schlattner tritt erneut, wie in seinen bisherigen Romanen, als grandioser Erzähler auf, als wortgewaltiger und phantasievoller Schöpfer von Gestalten und Geschichten. Auch allein deshalb lohnt es sich, heute im Zeitalter der schnellen und leichten Unterhaltung, zu diesem umfangreichen Band zu greifen.
Dafür belohnt der Autor den Leser (vor allem jene, die an der jüngeren Geschichte der Siebenbürger Sachsen und Rumäniens Interesse haben) mit der Schilderung seiner Jugendjahre in Stalinstadt/Kronstadt, mit Fragen betreffend Identität als Individuum und Gruppe in einer Zeit voller Bedrohungen und mit einer ungewissen Zukunft. Für ihn, zunächst als Außenseiter, der selber von Zweifel über sich und sein Aussehen (von seiner „Sattelnase“ bis zur ärmlichen Kleidung) geplagt war, waren Krisen, Enttäuschungen in der Liebe, aber auch die Suche nach einem eigenen Weg und immer wieder Gespräche über Gott und die Welt sozusagen vorprogrammiert. Zu Wort kommen Familienmitglieder, Kollegen, Lehrer mit ihren Anschauungen betreffend Geschichte und Religion, wobei zum Beispiel geschichtliche Ereignisse wie der Einmarsch der deutschen und nachher der russischen Soldaten oder die Gründung des neuen rumänischen Staates so wiedergegeben werden, wie sie damals empfunden wurden. Hinzu kommt die Angst, die Bedrohung, die einen ständig umgaben – „die blaue Katze“ in Kopf und Brust. Parallel dazu eingeflochten sind die Einschnitte in die zeitlos wirkende Gegenwart des Klosterlebens – eine beeindruckende, auch kritisch kommentierte Beschreibung der Zustände in der so mächtigen und prächtigen orthodoxen Kirche, verfasst von einem ihrer besten Kenner und ehrlichen Begleiter.
Die autobiographischen Züge sind in „Wasserzeichen“ dominanter als in den anderen Romanen, aber die Trennlinie zur Fiktion bleibt fließend. „Zuletzt weiß man nicht, was wirklich geschehen ist, es bleibt, was erzählt wird“, sinniert Schlattner, dessen Leben wirklich romanhaft erscheint mit allen Kontroversen und Konflikten, die ihn betrafen und ihn inzwischen, als wohlbekannten Schriftsteller und geschätzten Geistlichen weniger beschäftigen dürften.
„Jeder echte Dichter ist ein Till Eulenspiegel“ verteidigt im Roman eine Freundin Schlattner, als es seitens seiner Kameraden heißt, man könne ihm nicht alles glauben, was er, auf Anregung der Klasse, zu erzählen vorhabe.