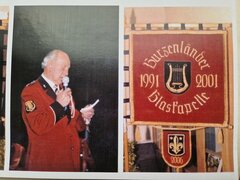Ein Zwölfjähriger erhält seine erste Trompetenstunde und fragt den Lehrer: „Kann ein Trompeter zu einem kleinen Vermögen kommen?“ Der Lehrer antwortet:„Ja, wenn er vorher ein großes hatte!“
Dieser bittersüße Witz findet sich neben zahlreichen ähnlichen im Nachlass von Ernst Fleps (1926-2009). Der Gründer und Dirigent der Burzenländer Blaskapelle hatte eine ganze Sammlung lustiger Texte angelegt, die er selbst bei Auftritten als Auflockerung im Programm vorlas. Aber der Witz sagt auch einiges über Ernst Fleps selbst aus. „Was geschieht mit meinen Gebrauchssachen nach meinem Tod? Da ich kein Vermögen besitze, kein Haus, keine Wohnung, keinen Grund, kein Geld, keine Möbel, können meine Kinder von mir nichts erben. Ich war und bin kein Materialist, habe mein ganzes Leben für andere gearbeitet...“ liest man in seinem Tagebuch.
Ernst Fleps war unser Musiklehrer an der deutschen Abteilung des Lyzeums Nr. 1, dem heutigen Șaguna-Lyzeum. Da ich als Kind erst Klavier und nachher Cello spielen gelernt hatte, musste ich in den Musikstunden nicht sonderlich aufpassen. Es gab aber Mitschülerinnen und Mitschüler, für die Musik ein gefürchteter Gegenstand war, denn Ernst Fleps war ein anspruchsvoller und strenger Lehrer. In der Schülerblaskapelle war die Stimmung eine andere: Ernst Fleps hatte es verstanden, uns schnell in die Anfangsgründe des Blasinstrumente-Spielens einzuführen und uns die Liebe zur Blasmusik zu vermitteln. Wir haben dabei viele fröhliche Stunden verbracht, bis hin zu den „Demonstrationen“ am 1. Mai und am 7. November. Da durften wir den Zug der defilierenden Lyzeaner anführen. Welche „Ehre“! Auch im Schülerorchester, dessen Leitung Ernst Fleps von Walter Schlandt (1902-1979) übernommen hatte, haben wir schöne Stunden verbracht. Allerdings befand sich das Orchester damals schon am absteigenden Ast. Als Anfänger am Cello durfte ich in der 6. Klasse noch die 1. Symphonie von Beethoven und die Paukenschlag-Symphonie von Haydn mitspielen. Am Lyzeum erlebte ich dann, wie das Orchester zusammenschmolz. Nicht dass Ernst Fleps es nicht gut gemacht hätte, nein! Es gab aber unter den Schülern kaum noch welche, die es am Instrument über das Anfängerstadium hinaus brachten. So ist dieses Schülerorchester unter seinen und unseren Augen eingegangen.
Nach einem Musikstudium in Klausenburg kehrte ich nach Kronstadt zurück. Am Honteruslyzeum war Ernst Fleps plötzlich mein Kollege. Er leitete den großen, ich den Kleinen Chor des Honteruslyzeums. Obzwar er die weitaus undankbarere Aufgabe hatte, ließ er nie durchblicken, dass ihm der junge Kollege als Konkurrent im Wege stand. Im Gegenteil: im Kleinen Chor sang er mit, seine herrliche Tenorstimme war er ein Vorbild für die gerade aus dem Stimmbruch kommenden Jungen. Für das Männerquartett der Professoren (Wilfried Schreiber, Detlef Hermannstädter, Ernst Fleps und Kurt Philippi) war er ein idealer Erster Tenor! Die Zusammenarbeit mit ihm, besonders die ersten gemeinsam organisierten Burzenländer Chortreffen, sind mir in bester Erinnerung geblieben.
Unsere Wege trennten sich durch meine Übersiedlung nach Hermannstadt im Jahr 1985. Ab und zu gab es ein Wiedersehen, etwa beim Sachsentreffen in Birthälm oder beim Treffen auf dem Huetplatz in Hermannstadt. Ernst Fleps dirigierte „seine“ Burzenländer Blaskapelle, ich saß jedesmal in der Nähe und freute mich als gewesener F-Bass-Bläser am Klang der Blasmusik.
Ernst Fleps starb im Jahr 2009. Sein Grab befindet sich auf dem Innerstädtischen Friedhof von Kronstadt. Dorthin führt mich mein Weg an jedem ersten November mit einer Kerze zu seinem Gedenken. Ich habe ihm viel zu verdanken.Vor zwei Jahren starb seine Lebensgefährtin Sabine Vu{muc. Ihre Tochter Karin Bruss übergab mir den schriftlichen Nachlass von Ernst Fleps mit der Bitte, ihn durchzusehen und zu ordnen. Bei diesem Streifzug durch seinen Nachlass bin ich Ernst Fleps 16 Jahre nach seinem Tod noch einmal begegnet und habe ihn dabei von einer ganz anderen Seite kennengelernt.
Aus seinem Nachlass tritt uns ein Mann entgegen, der ein Leben lang, wo immer er war, ein Notenheft, einen Bleistift und einen Radiergummi bei sich hatte. Im Ferienlager in Costine{ti, auf einer Wanderung bei Törzburg, im Urlaub in der Bukowina oder im österreichischen Gosau, überall lagen Melodien in der Luft, die er zu eigenen Kompositionen oder zu Sätzen für die von ihm geleiteten Ensembles umwandelte. In den Winterferien war Ernst Fleps oft zu Besuch bei seiner Mutter in Mediasch. Auch dort „küsste ihn die Muse“: Unter dem dreistimmigen Chorsatz Tanz mit den Noten lesen wir: „Mediasch, 29. XII. 1983, 4,30 h, beim Schlangestehen um Milch.” Und dies ist nicht der einzige Eintrag dieser Art!
Welches waren die Ensembles, für die Ernst Fleps komponierte oder orchestrierte? In seinen jungen Jahren, als Lehrer in Tartlau, leitete er dort ein Orchester, die Blaskapelle, einen Chor und eine Theatergruppe, später waren es die Blaskapellen von Brenndorf und Zeiden, der Zeidner Männerchor, danach auch der Zeidner Kirchenchor. Wo ein Dirigent wegfiel, sprang er ein.1991 gründete er die Burzenländer Blaskapelle und fing damit die Bläser auf, die in ihren Gemeinden allein geblieben waren. Dieses Ensemble, in dem er nicht nur Dirigent sondern auch Manager war, forderte seinen ganzen Einsatz, es erfüllte ihn aber auch mit Stolz. Bis kurz vor seinem Tod hat er dieses sein Lieblingskind mit voller Hingabe betreut.
Ernst Fleps war nicht nur Komponist, sondern auch Liedermacher. Sowohl Texte als auch Melodien kamen gelegentlich aus seiner Feder. Für seine Kronstädter Gymnasialschüler hat er viel und gerne komponiert. Dabei sind zahlreiche Lieder für Kinderchor und Orff-Instrumente gesetzt. Der Einsatz der Orff-Instrumente war damals ein Novum. Ernst Fleps war rumänienweit ein Vorreiter dieses musikpädogogischen Ansatzes.Einige seiner Texte wollen das Schülerleben der Zeit vor 1989 thematisieren und sind daher nicht frei vom ideologischen Einschlag der Zeit: „Herbstlich wehn die Winde, es ist Erntezeit./ Traktor und auch Roder stehen längst bereit./ Schüler, Pioniere fröhlich sind dabei,/ wenn es gilt Kartoffeln buddeln – eins, zwei drei!“ Solche Texte zeugen vom ideologischen Druck, dem die Lehrer wie auch die Schüler damals ausgesetzt waren. Es gibt aber unter seinen Dichtungen auch sehr besinnliche („ Abendlied“, „Am Bache“, „Verzicht“) und sehr fröhliche Texte („Mädchen, komm und tanz mit mir“, „Wenn die Trompeten rufen zum Tanz“), die auch heute noch Bestand haben.Neben eigenen Texten hat Ernst Fleps auch Gedichte seiner Zeitgenossen vertont: Als Beispiele seien „Des Herzens Stundenschlag“ von Georg Scherg sowie „Ich bin ein junger Jagdgesell“ und „Das weiße Birkenkreuz“ des Zeidner Dichters Walter Player genannt.
Den Großteil des Nachlasses machen die vielen Sätze und Eigenkompositionen für Blaskapellen aus. Ausgangspunkt war dabei das „klassische“ Blasmusikrepertoire von Martin Thies (1881-1940): Walzer, Märsche und Polkas. Auch diese Stücke mussten oft umgesetzt werden, um sie an die Möglichkeiten der jeweiligen Besetzung anzupassen. Dabei beobachtet man bei Ernst Fleps eine Verlagerung der Melodie von den Flügelhörnern zu den Trompeten. War die Trompete bei Martin Thies noch ein Zuschlaginstrument, so hat sie in der heutigen Burzenländer Blaskapelle dem Flügelhorn bereits den Rang abgelaufen und glänzt als Hauptstimme. Ernst Fleps war stets bemüht, das traditionelle Repertoire für Blasmusik zu erweitern. Zu den klassischen Genres Marsch, Walzer und Polka kamen Stücke aus anderen Kulturkreisen hinzu, nicht zuletzt Schlager aus der deutschen Unterhal-tungsmusik.Für alle diese Stücke gab es keine Noten. Für jeden Bläser musste eine Stimme von Hand geschrieben werden. Auch viel später, als die Möglichkeit der Xerokopie hinzukam, musste jeweils ein Exemplar als Vorlage per Hand geschrieben werden. Neben den vielen Partituren hat Ernst Fleps auch eine große Anzahl von Stimmsätzen für seine Bläser geschrieben. Aus diesem Nachlass tritt uns nicht nur ein bienenfleißiger Kapellmeister entgegen, sondern auch ein Mann mit einer wunderschönen, ausgeglichenen Handschrift.Lieber Ernst, aus solchen Noten singt und spielt man gerne!