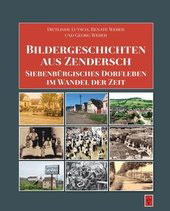Zeitreise in eine verschwundene und vergessene Welt würde ich den Bildband nennen, den die Autoren – inzwischen ist Georg Weber, der Verfasser der Einführung, 2013, gestorben – in einer sechsjährigen mühseligen und liebevollen Arbeit zustande gebracht haben. Eine Zeitreise, weil die Bilder uns erlauben, uns mental in vergangene Zeiten hineinzuversetzen und die vielfältigen Vorgänge der letzten hundert Jahre visuell nachzuvollziehen. Die Fotografien sind somit nicht einfach die visuelle Begleitung der Themen, die in den acht Kapiteln des Bandes behandelt werden: Dorf und Kirche; Familie; Kindheit und Jugend; Kirchliches Leben; Soziales Leben; Arbeiten und Wirtschaften; Kriegswirren und ihre Folgen; Zerstreuung und neue Sammlung. Die Bilder bilden vielmehr die dokumentarische Grundlage des Buches. Die kurzen Begleittexte sind eine Einleitung zu den Bildern, die nicht zu „Bildmaterial“, zu Anhängseln des Textes verkommen, sondern ihre eigene Würde haben. Dadurch dass, insofern möglich, die abgebildeten Personen identifiziert wurden, erhält eine vergangene und vergessene Welt ihr Gesicht.
Dem Band liegt auch eine wissenschaftliche Vorarbeit zugrunde. Georg und Renate Weber haben 1985 eine Monografie, „Zendersch. Eine siebenbürgische Gemeinde im Wandel“, veröffentlicht, die alle Ebenen und Dimensionen des dörflichen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart umfasste. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Zendersch/Senereuş sowie die emotionale Bindung an die Gemeinde, aus der Georg Weber übrigens stammte, haben den Bildband geprägt. Die Struktur des Buches und der Inhalt der Begleittexte haben die notwendige intellektuelle Stringenz, sind aber dennoch liebevoll, ohne nostalgisch oder sentimental zu sein. Die Vergangenheit wird nicht verklärt und es wird mit ihr auch nicht abgerechnet – der erhobene Zeigefinger fehlt ebenso wie die Heroisierung oder Verklärung der „guten alten Zeit“ oder das Selbstmitleid. Zendersch ist aus mehreren Gründen eine vergessene und verschwundene Welt. Dass seit 1993 in Zendersch kein einziger Sachse mehr lebt, wäre Grund genug, von einer verschwundenen Welt zu sprechen. Allerdings nur, wenn wir die „reale“ Gemeinde im Kreis Mureş in Betracht ziehen, denn das „virtuelle“ Zendersch existiert weiterhin in der Zerstreuung – in Deutschland, Österreich, den USA oder Kanada. Deshalb heißt das letzte Kapitel auch: Zerstreuung und neue Sammlung. Zendersch hat aber für manche seiner ehemaligen Bewohner aufgehört zu existieren, es ist ein abgeschlossenes und auch begrabenes Kapitel in einigen Biografien.
Zendersch ist eine vergessene Welt, weil sie keine typische sächsische Ortschaft war. Sie lag nämlich nicht auf dem Königsboden, sie war bis 1848 ein Hörigendorf. Die Zenderscher Sachsen gehörten also nicht zur sächsischen Nation, wohl aber zur evangelischen Kirche. Gerade die Geschichte der sächsischen Hörigendörfer ist ein schändlich vernachlässigtes Kapitel der – nicht nur – siebenbürgisch-sächsischen Geschichtsforschung. Sächsische Hörige wurden und werden erwähnt, gewissermaßen als exotisches Anhängsel der „eigentlichen“ Sachsen. (Eine bittere Ironie der Geschichte war, dass Andreas Schmidt, der Volksgruppenführer, ein – für damalige Verhältnisse – Quereinsteiger vom ehemaligen Komitatsboden war). Das Verschwinden der Gemeinde ist mit der Evakuierung gegen Ende des Zweiten Weltkrieges (1944) in Beziehung zu bringen: Zendersch lag zwar südlich der 1940 gezogenen rumänisch-ungarischen Grenze, wurde dann aber im Herbst 1944 evakuiert. Die anfangs nur als vorübergehend betrachtete Evakuierung verwandelte sich in eine lange und schmerzliche Irrfahrt durch das von Kriegswirren zerrissene Mitteleuropa. Nach Kriegsende kehrten einige Zenderscher heim, andere verblieben in den verschiedenen Besatzungsgebieten, die später zur Bundesrepublik Deutschland, zu Österreich oder zur DDR wurden. Die Heimkehrer hatten nach einer Zeit der Entrechtung versucht, sich in der neuen Gesellschaft des kommunistischen Rumäniens zurechtzufinden, wanderten aber schließlich aus. Das „reale“ Zendersch existiert somit nur noch in der Vergangenheit, wobei die Erinnerung an das ehemals sächsische Dorf von den „neuen“ Bewohnern, deren Vorfahren meist nach dem Zweiten Weltkrieg in dem Dorf angesiedelt wurden, in bescheidenem Maße aufrechterhalten wird.
Die Fotografien dokumentieren aber auf subtile Weise den Auflösungsvorgang der traditionellen Gemeinde, der schon vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat. Um die Bilder zu verstehen, ist ein kleiner Exkurs in die Fotogeschichte notwendig. In Siebenbürgen hatte die Fotografie verhältnismäßig schnell Eingang gefunden, und zwar noch in der Zeit der Daguerreotypie. Da diese aber teuer war, haben wir aus der Frühzeit der siebenbürgischen Fotografie nur Bilder von Adligen. Somit gibt es keine Bilder der hörigen Bauern, denn die Hörigen waren nicht außergewöhnlich genug, um die teuren fotografischen Materialien für ihre Abbildung zu verschwenden. Als sich die eigentliche Fotografie in Siebenbürgen durchsetzte, gab es dort kein „Joch der Hörigkeit“ mehr. Somit gibt es im Band nur Bilder von freien Menschen und die Nachkommen der sächsischen Hörigen lassen sich von den Königsbodener Sachsen nicht unterscheiden.
Eine zweite Anmerkung betrifft die Ausdrucks-und Aussagefähigkeit der Fotografien. Der Großteil der Fotos ist gestellt, was für die ältesten Bilder auch mit der technischen Entwicklung zu tun hat. Selbst als das Fotografieren dank des technischen Fortschritts leichter und zugänglicher wurde, blieben fotografische Aufnahmen in der Regel bedeutenden Ereignissen vorbehalten. Aber selbst in der Kunstfotografie des 20. Jahrhunderts haben sich „spontane“ Aufnahmen als gestellte Bilder entlarvt, etwa jenes des sterbenden Republikaners von Robert Capa oder der Rotarmisten, die die sowjetische Fahne auf dem Reichstag hissen. (Die Selfies sind ebenfalls gestellt).
Wenn es also um die Fotografien aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg geht, müssen wir deren Aussagekraft immer mit dem Hinweis auf die technischen Möglichkeiten jener Zeit relativieren. Und trotzdem: Auf allen Bildern blicken die Männer ernst, manche geradezu finster drein, die Frauen abgehärmt. Auf den Bildern der Zwischenkriegs- und Kriegszeit hingegen lösen sich langsam die verkrampften Gesichtszüge. Freilich, das Fotografieren war leichter geworden, die Vorbereitungszeit wurde kürzer, die Gefahr der verwackelten Bilder geringer. Doch lässt sich der Vorgang nicht allein auf technische Fragen zurückführen. Der Erste Weltkrieg hatte zweifellos die Rolle eines Katalysators gespielt und die Modernisierung des Dorflebens beschleunigt. Zurückgeblieben war das Dorf auch vorher nicht, zumindest nicht in materieller Hinsicht. Das Leben mag karg gewesen sein, aber Kargheit prägte das Leben der meisten Europäer, in Ost und West gleichermaßen. Und wenn man etwa die Bilder der Bewohner der Appalachen aus der Zeit der Weltwirtschaftskrise mit denen der Zenderscher Bauern vergleicht, dann merkt man den Unterschied zwischen bitterer Armut und Kargheit.
Was der Erste Weltkrieg ausgelöst und der Zweite vollendet hatte, war aber die Modernisierung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Die althergebrachte Ordnung scheint intakt zu sein, selbst auf den Bildern aus den 1960-1970er Jahren funktioniert sie, trotz der von Krieg, Evakuierung, Deportation, Enteignung verursachten Einbußen. Und es ist trotzdem eine andere Welt, die die Reste der alten zwar in der Diaspora weiterpflegt, aber in einem Kontext, der die Beachtung der Regeln in Bestandteile eines Lifestyles verwandelt. Diese Auflösung, die zwar von außen gefördert wird und sich schließlich mit Gewalt durchsetzt, aber die, oft unbewusst, auch in die Gemeinschaft getragen wurde, dokumentieren die Bilder auf eine subtile Weise.
Dietlinde Lutsch, Renate Weber und Georg Weber: „Bildergeschichten aus Zendersch. Siebenbürgisches Dorfleben im Wandel der Zeit“, Schiller-Verlag Hermannstadt-Bonn 2016