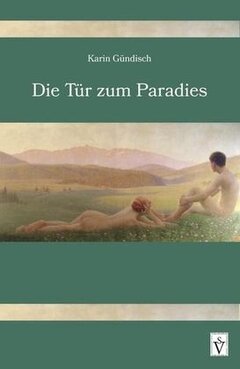Weibliche Sexualität – nicht nur ein Tabuthema, vor allem für Frauen mit einer inneren Scheu vor dem Zugeständnis physischer Lust. Lust am falschen Platz kann Angst machen, wie in der Geschichte der Anhalterin, die mit Befremden feststellt, wie ihr Körper auf die männliche Präsenz neben ihr reagiert, ihr Kopf hin und hergerissen ist zwischen dem Reiz des Verbotenen und moralischen Prinzipien, etwa der Treue zu ihrem Ehemann, und Angst vor den Folgen dieser elektrischen Spannung, die der junge Mann neben ihr ebenfalls bemerkt.
Wird das mühevoll aufrecht erhaltene Gleichgewicht gleich in die eine oder andere Richtung schwappen, unkontrolliert und mit unangenehmen Folgen? Wird er sie anmachen oder gar belästigen oder noch Schlimmeres, warum parkt er jetzt mitten im Wald? Ach ja, er muss nur pinkeln. Musst du nicht auch, fragt er, und sie verneint, obwohl es nicht stimmt. Hofft, dass er wirklich nur „muss“. Und stellt sich vor, wie er es tut, wie sie es verbotenerweise erregt. Sein Pinkeln. Sie lässt die Gedanken in die verbotene Richtung nicht zu, wehrt sich, ist verwirrt. Warum gibt es das? Sie ist doch verheiratet! Sehr jung verheiratet, noch Studentin. Die Frage, wie das ist mit der lebenslangen Treue an der Seite des Einen darf sie sich nicht stellen – und wird am Ende der Geschichte doch unfreiwillig damit konfrontiert.
Träume und verpasste Chancen
Die Geschichten in „Die Tür zum Paradies“, mit denen Karin Gündisch das wohlbekannte Terrain als Kinderbuchautorin verlässt, beleuchten die weibliche Sexualität aus allen Richtungen: verdrängte Lust, Sexualität als Tauschware gegen lebenslange Einsamkeit, oder auch als rettende Flucht in parallele Realitäten, wie bei der gelähmten, hochbetagten Martha im Pflegeheim, die sich in einen jungen iranischen Pfleger verliebt hat. „Martha ist übergschnappt“, urteilt die Schwiegermutter der Ich-Erzählerin. „Auf eine sehr angenehme Weise, sage ich. Es gibt Schlimmeres.“
Oft geht es in den Geschichten auch ums Älterwerden, das Verpassthaben von Chancen, den vor Augen stehenden körperlichen Verfall, um festgefahrene Strukturen oder Ausbruchsversuche aus solchen, vom Regen in die Traufe, wie bei Eva und Ricky, die sich nach der Scheidung wieder wie am Anfang gegenüberstehen: „die Liebhaber daneben, die Kinder dazwischen“ und feststellen, dass der andere doch gar keine so schlechte Figur macht...
Es geht um Tod und Neubeginn. Trostlosigkeit, Vernunft und Funken des Aufbäumens dagegen. Und immer wieder um die alte Heimat der Autorin: Martha hatte die Deportation miterlebt. Ida wandert mit Tochter Renate, Enkelin Nena und dem schwerkranken Ehemann Karl nach Deutschland aus. Wer nicht mitkommt, ist der missratene rumänische Schwiegersohn, Tudor, der Nichtsnutz. „Ich war dagegen, dass du einen Rumänen nimmst. Das hast du jetzt davon“, sagt Ida harsch. Renate kontert bitter: „Du hast Not zu reden! Wo der Vater um den Küchentisch herum hinter der Frieda rennt!“ Momente der Wahrheit. Aufdecken, wieder zudecken, wegsehen. Auch beim Offensichtlichen: Wenn eigentlich alle von einem Hund sprechen, aber nur auf Annas Busen gucken.
Die Kurzgeschichten halten uns Frauen den Spiegel vor: Was wir einst träumten. Was wir wollten. Was wir nicht sehen wollen oder nicht dürfen sollen. Die Unvermeidlichkeiten einer weiblichen Biografie.
Biografie einer Gebärmutter
Um Letzteres geht es auch im zweiten Teil in einer einzigen, längeren Geschichte. Und um einen ganz anderen Aspekt der weiblichen Sexualität: Das Kondom ist geplatzt... und damit auch Adinas Urlaub! Während sich Ehemann Arno und die halbwüchsigen Kinder dem entspannten Skifahren hingeben und Adina verkrampft den Anfängerhang hinunterkurvt, kreisen ihre Gedanken um das eine, das vielleicht jetzt ihr Leben verändert, aus der Bahn wirft, das unvermeidliche weibliche Schicksal, Segen oder Fluch, Quelle des Glücks oder Leids unzähliger, das sie einholt: das Kinderkriegen. Umgeben von ihren Lieben, behütet, in stabilen Verhältnissen lebend, ist sie damit doch allein, Opfer und Heldin in einem. Schwanger oder nicht? Immer noch kein Blut, trotz Tablette danach. Telefonate mit dem Arzt. Abtreiben? Wieder...
Lange durfte man es nicht in Rumänien, mindesten vier Kinder sollte jede Frau zur demografischen Rettung einer alternden Gesellschaft gebären. Blutsturz, lebensgefährlich: Fehlgeburt oder versuchte Abtreibung? Argwöhnisch urteilten Mediziner, inkriminierten, verweigerten Ausschabungen, wollten sich nicht schuldig machen, das Gesetz auf ihrer Seite. Für die Krankenakte: Wieviele Geburten? Wieviele lebende Kinder? Anzahl der Kürettagen? Biografie einer Gebärmutter. „Männer, unnahbar, geschlechtslos, als hätten sie persönlich mit der Zeugung nie etwas zu tun gehabt“ sitzen über Adina zu Gericht. Ihre Frauen und Freundinnen, ihre Töchter und Enkelinnen aber haben dieselben Sorgen wie Adina.
Und der Lohn? „Zwei Kinder, hatte der Arzt gesagt, und der Orgasmus kommt von selbst.“ Nach den Kindern aber war das lange Zeit nicht mehr wichtig gewesen. „Die Pille, hatte der nächste gesagt, und alles geht in Ordnung.“ Doch die Pille hatte in Adina nur Fressorgien ausgelöst. „Einen anderen Mann, hatte die Freundin gesagt, und du wirst Wunder erleben. Das war alles nur blödes Gerede.“
„Als ich diese Erzählung schrieb, gab es in Deutschland heftige Diskussionen um den Paragrafen 218 aus dem Strafgesetzbuch, der einen Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt“, motiviert Karin Gündisch in „Anstelle eines Nachworts“, warum sie ausgerechnet dieses Thema wieder aufgegriffen hat. Nicht nur, weil sie die Kriminalisierung der Abtreibung schon aus der Diktatur in Rumänien kannte. Sondern weil es bis heute ein Politikum ist, an dem sich die Geister heftig scheiden. In aller Welt, auch in Demokratien, ist die Diskussion wieder aufgeflammt, die den Frauen das Recht über die ohnehin schwerste aller Entscheidungen per Gesetz nehmen will. Die Erzählungen in „Die Tür zum Paradies“ vermitteln einfühlsam die Brisanz und Komplexität einer Frage, die eben nicht einfach nur mit einem „dafür“ oder „dagegen“ abgehakt werden kann.