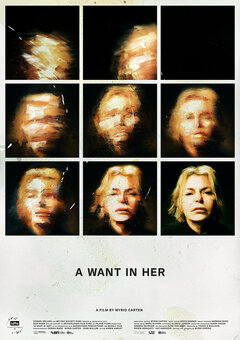Am Freitag, dem 17. Oktober, ist es wieder soweit: das Astra-Filmfestival AFF in Hermannstadt/Sibiu beginnt. Zehn Tage lang werden starke Geschichten von echten Menschen gezeigt, heiße Themen besprochen, Perspektiven geändert.
Die 32. Auflage des ältesten Filmfestivals Rumäniens bringt dutzende Leinwandgeschichten in 11 thematischen Sektionen vor das Publikum, viele davon sind Welt- oder Rumänien-Premieren.
Es geht dieses Jahr um Frauen, die zusätzlich zu ihren Rollen als Mutter und Angestellte, stark herausgefordert werden. Es geht um Männer in der Krise und es geht um Kämpfer an der Front. Das Erwachsenwerden wird thematisiert und das Leben mit einer süchtigen Mutter. Nicht weniger wichtig sind die Filme über den Einfluss der Medien und die Folgen des Neofaschismus auf unser Leben und auf die heutige Gesellschaft.
Glänzende Zukunft
Andra MacMasters´ Dokumentarfilm „Bright Future“ (Glänzende Zukunft, 2024) geht auf den Sommer von 1989 ein, als sich rund 20.000 Leute aus 166 Ländern in Nordkorea versammelten, um an einem Studentenfest teilzunehmen. Das Festival hatte politische Ansätze – nukleare Entwaffnung, Sicherheit, Umweltschutz, Rechte der Frauen und der Studenten und darüber hinaus den Frieden. Es fand allerdings an einem historischen Wendepunkt statt.
Die rumänische Filmemacherin will durch ihren Debütfilm auf die Geschichte und die Erfahrungen früherer Generationen von jungen Menschen hinweisen und auf ihren Umgang mit den Traumata des Krieges. Die komplexen Strukturen internationaler Jugendorganisationen, die sich für Frieden und Solidarität einsetzten, sind in Vergessenheit geraten oder ganz verschwunden. „Nach 35 Jahren ist es an der Zeit, über diese Plattformen nachzudenken, die es der Jugend ermöglichten, ihre Meinung zu den aktuellen weltpolitischen Entwicklungen zu äußern und eine gerechtere Gesellschaft zu bauen“, so MacMasters.
Der Film gehört zur Sektion „Diktaturen“, die ein Überlebenshandbuch für die mögliche Rückkehr totalitärer Systeme bietet.
Soldaten sind Menschen
In der Sektion „Auf beiden Seiten der blutigen Front“ zeigt die Dokumentation „Mr. Nobody Against Putin“ (Herr Niemand gegen Putin, 2025) einen Grundschullehrer in Russland, der heimlich eine verblüffende Realität filmt. Die Schüler, eine Generation künftiger Wehrpflichtiger im Krieg gegen die Ukraine, werden einer Gehirnwäsche unterzogen. Im Rahmen von Stunden für politische Bildung, nach Angaben des Kreml, wird ihnen Putins Propaganda eingetrichtert. Der Film ist Dänemarks Vorschlag in der Oscarkategorie „Bester internationaler Film“.
Dieselbe Sektion verschafft direkten Zugang auf beiden Seiten der blutigen Front in der Ukraine und Afghanistan. „Mein lieber Theo“ (2025) bietet einen bisher nur seltenen Blick direkt an der Frontlinie in der Ukraine. Filmemacherin Alisa Kovalenko ließ ihren Partner und den vierjährigen Sohn Theo zurück, um Teil der Freiwilligenarmee zu werden und gegen Russland zu kämpfen. Sie filmte ihre Kameraden, viele davon Eltern, in Momenten der Kameradschaftlichkeit und wenn sie mit ihren Kindern virtuell telefonierten. Ihre eigenen Gespräche mit Theo sowie Aufnahmen der eigenen Gedanken und Erfahrungen im Krieg schnitt sie zu einem Dokumentarfilm in Form eines Tagebuchs zusammen. Das Bild von Menschen voller Emotionen, Sehnsüchten und Ängsten verhilft dazu, die Soldaten zu verstehen und gegebenenfalls Empathie für diese zu entwickeln, egal an welcher Front sie kämpfen.
In einem Exklusivinterview für die Zeitschrift „Variety“ sagte Kovalenko, sie glaube, der Dokumentarfilm sei der Schlüssel zum Herzen. Er könne Empathie und Verbindungen schaffen.
Dadurch, dass man die Soldaten nicht als abstrakte Kämpfer, sondern als Eltern, als einzelne Wesen betrachtet, die ihre eigenen Geschichten haben, verblassen vielleicht Hass und Rachsucht – zumindest ein bisschen.
Die Folgen von Neofaschismus
Von Politik handelt auch die Sektion „Neofaschismus online und offline“. Die ausgewählten Filme gehen auf die Entstehung und Nährung von Neofaschismus und rechtsextreme Bewegungen ein. Marcin Wierzchowski zeigt in der deutschen Produktion „Das deutsche Volk“ (2025) die Geschichte des rassistischen Anschlags in Hanau im Jahr 2020, als ein Mann in wenigen Minuten neun Menschen ermordete, weil er glaubte, sie seien keine Deutschen. Der Regisseur verfolgt vier Jahre lang Überlebende und Hinterbliebene des Anschlags und vertiefte sich in ihren Umgang mit Trauer und Verlust.
Wierzchowski thematisiert auch den Kampf seiner Protagonisten um Anerkennung in einem Deutschland, in dem manche von ihnen aufgewachsen sind und sich zuhause fühlen. In ihrem Bestreben stehen sie aufgrund der Hilflosigkeit der Behörden ziemlich verlassen da.
Die Macht des Internets
My Vingren, eine berühmte schwedische Journalistin, verfolgte undercover mit einem falschen Profil ein Online-Netzwerk von weißen Suprematisten. Sie erfährt, wie diese Einzelpersonen rekrutieren und beeinflussen, sie radikalisieren, zu Hass und Fremdenfeindlichkeit aufhetzen. Ihre Investigation über die Folgen des Neofaschismus hat allerdings einen Preis.
In „Hacking Hate“ (Hass aufdecken, 2024) kann man einen tiefen Einblick in ein erschreckendes Netzwerk bekommen.
Auch andere Filme greifen auf die Problematik des anscheinend außer Rand und Band geratenen Internets zurück. Sie verdeutlichen die Toxizität des Online-Raums, der ein fruchtbarer Boden für Extremismus geworden ist.
Die deutsche Produktion „Girl Gang“ (2022) von Susanne Regina Meures ist nicht zu verpassen. Die 14-jährige Influencerin aus Berlin scheint ein Märchen zu leben, doch hat ihr großer Erfolg auch seine Kosten.
Männer in der Krise
In einer eigenen Sektion werden die Krisen der Männlichkeit anhand verschiedener Herausforderungen behandelt. Chinesische Jungen lernen in einem Kurs, wie man flirtet, ein junger, geschiedener Mann zeigt sein Leiden und ein Vater versucht zu verstehen, wo er in der Erziehung seines viel zu früh verstorbenen Sohnes versagt hat. In seinem zutiefst persönlichen Dokumentarfilm „The Portrait of a Confused Father“ (Portrait eines verwirrten Vaters, 2025) sucht der norwegische Filmemacher Gunnar Hall Jensen nach Antworten. Er blickt auf die gemeinsame Zeit mit seinem rebellischen Sohn. Das Archivmaterial, das er seit der Geburt des Sohnes, vor über 20 Jahren, filmt und sammelt, zeigt die unterschiedlichen Etappen ihrer Beziehung und geht auf Liebe wie auch auf Schwierigkeit und Schönheit der Elternschaft ein. Nach dem Tod des Sohnes bleibt der Vater mit vielen Fragen und der Notwendigkeit, seinen Verlust irgendwie zu verarbeiten.
Neue Frauenrollen
In „Cabin pressure“ (Kabinendruck, 2024) werfen Eszter Nagy und Sára Czira ein ungewöhnliches Thema auf. Menschen, die keine romantischen Verbindungen zueinander pflegen, aber zu Eltern werden. Die 36-jährige Heni ist erfolglos in ihrem Wunsch, die Liebe ihres Lebens zu finden und eine Familie zu gründen. Auf einer Co-Parenting-Plattform findet sie einen Partner; er ist homosexuell. Auch er wünscht sich ein Kind, allerdings keine Beziehung. Gemeinsam sollen sie das Kind bekommen und großziehen. Kann das funktionieren?
Auch Soldatenfrauen, Ersatzmütter oder alkoholabhängige Frauen erzählen bei AFF ihre Geschichten.
Beim AFF sind auch einige Produktionen zu sehen, die Kunst als Werkzeug für Selbstentdeckung und -heilung zeigen: Gedicht und Tanz werden Formen des Lebens, der Heilung der menschlichen Beziehung.
Den Filmen bei den Dokumentarfilm-Festspielen in Hermannstadt folgen Diskussionen mit Filmemachern, Produzenten, Protagonisten oder Fachleuten.
Astra Junior
In den letzten 16 Jahren hat sich Astra Film Junior zum umfassendsten Programm für Bildung der Kinder und Jugendlichen mithilfe des Dokumentarfilms im Land entwickelt. Grundschüler, Gymnasialschüler und Teenager finden hier altersgerechte Leinwandgeschichten und werden herausgefordert, selbst zu denken, zu fühlen und auch, sich Fragen zu stellen.
Die Sektion für die junge Generation findet genau während des Programms „Grüne Woche“ statt, sodass Klassen teilnehmen können und sich mit Themen wie Freundschaft, Anpassung an ein neues Leben, Armut, Krieg, Flucht oder Internetsucht auseinandersetzen können. Die jungen Zuschauer erhalten Kontexte und Erklärungen von Fachleuten und lernen, sich Gedanken zu aktuellen, wichtigen Themen zu machen. Eines der Ziele ist es, das Scrollen in den sozialen Medien durch Nachdenken zu ersetzen, Manipulation zu erkennen, ethisch und mit Argumenten mit heiklen Themen umzugehen.
Das AFF ist eines der bedeutendsten Dokumentarfilmfestivals in Europa. Informationen zu allen Filmen sowie zum Programm sind unter astrafilm.ro zu finden.