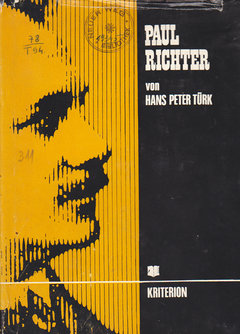Paul Richter (28. 8. 1875 – 16. 4. 1950) komponierte seine Sechste Symphonie in den schweren ersten Jahren nach Kriegsende. Die einzige erhaltene Orchesterpartitur aus Richters Nachlass enthält auf der Titelseite nur diese Angabe: „Okt. 1946 …in herzlicher Verehrung zugeeignet vom Componisten. 1.1.1949.” Die angegebenen Jahreszahlen bezeichnen vermutlich auch die Entstehungszeit. Es sind Jahre tiefgreifender Veränderungen in Rumänien, der brutalen Beseitigung einer konstitutionellen Monarchie und der Installierung einer kommunistischen Diktatur nach sowjetischem Muster (30. Dezember 1947). Richters letzte Symphonie ist ein Abbild jener Jahre. Sie gestaltet, vor allem in den ersten beiden Sätzen, persönliches und geschichtliches Erleben als künstlerische Aussage.
Noch vor Kriegsende, im Januar 1945, wurden zwei Kinder Richters, zusammen mit 70.000 deutschsprachigen rumänischen Staatsbürgern, in die Sowjetunion zur Aufarbeitung der Kriegsschäden deportiert, aufgrund des von Stalin persönlich erlassenen Dekrets vom 16. Dezember 1944. Bis zur Revolution von 1989 konnte in Rumänien über das Trauma der Deportation öffentlich weder gesprochen, noch geschrieben werden. In meiner vor 45 Jahren veröffentlichten Monografie über Paul Richter (Kriterion Verlag, Bukarest 1975, S. 56) durfte zu dieser tragischen Situation nur angemerkt werden, dass „seine beiden Kinder, Kurt und Hedwig… in den Nachkriegsjahren von ihm getrennt wurden.” In seiner Verzweiflung suchte Paul Richter Trost beim damaligen Bischof der Evangelischen Kirche Viktor Glondys. Wilhelm Richter, der Sohn des Komponisten, hatte Verständnis dafür, dass damals über die Russlanddeportation nicht in aller Deutlichkeit hätte berichtet werden können, als er mir schrieb (Brief vom 26. März 1974): „...dass ich sicher bin, dass die Briefe Vaters an Glondys Verzweiflungsschreie wegen der seelischen Misere – zwei Kinder in Russland, und ich spurlos verschwunden in Bukarest untergetaucht – und wahrscheinlich auch die wirtschaftliche Misere damals, waren. Diese hätten Ihnen wohl einen Einblick in den verzweifelten Zustand gegeben, in dem sich Vater damals befand, aber einesteils wissen Sie davon, andernteils könnten Sie hierüber nicht viel schreiben – auch heute noch nicht! Welche Ausmaße diese Misere auf seine ganze Persönlichkeit angenommen haben, sehen Sie ja schließlich in der umstrittenen 6. Symphonie.”
„Umstritten” ist das viersätzige Werk nicht nur wegen der Auswirkung dieses biographischen Hintergrunds auf die künstlerische Gestaltung eines großangelegten symphonischen Werkes. Dass Richter trotz Sorge um seine beiden deportierten Kinder (deren Tod in Russland ihm verheimlicht wurde), fast vollständiger Taubheit, Lähmung beider Beine, Blindheit auf einem Auge und „wirtschaftlicher Misere” die Symphonie trotzdem beenden konnte, ist eine bewundernswerte Leistung.
Diese letzte der Symphonien Paul Richters konnte jedoch vor der Wende von 1990 ihrer Deportationsthematik wegen „nicht für die Öffentlichkeit” empfohlen werden (Monographie, S. 57). Das Werk hätte damals auch aus einem zweiten Grund keinen Platz in öffentlichen Konzerten gefunden. Im Schlussabschnitt des ersten Satzes (und nur hier) erscheint nämlich ein kurzer Choreinsatz mit Sopran-Solo auf diesen, von Richter selbst verfassten, Text:
„Hilf, Herr! Dem Volk droht das Ende!
Herr, hebe die Hände!
Und wend´ zum Lohn
uns Spott und Hohn!
Hilf, Herr, o hilf, Herr, aus schrecklicher Not!
Hilf uns, hilf uns, Herr!
O, lieber Gott, verlass uns nicht
jetzt in der schwersten Not,
hilf uns, o hilf uns, Herr, aus schwerster Not.
Hilf uns, o Herr, hilf uns, Herr!”
Ein Werk geistlicher Prägung mit Deportationshintergrund, inmitten atheistisch-kommunistischer Diktatur aufzuführen, war vor 1990 unvorstellbar. Schon die eindeutige Erwähnung dieser Merkmale in der Monographie von 1975 musste unterlassen werden, ebenso die Veröffentlichung obenstehenden Textes.
Über Richters Einstellung betreffend Kirche und Glauben schrieb Wilhelm Richter (Brief vom 1. Dezember 1973) mit Bezug auf Bischof Viktor Glondys: „… dass sich Menschen wie Vater, die weder Kirchgänger noch tiefgläubig waren, doch gerne an diese Persönlichkeit wandten, mit viel Vertrauen, wenn sie in großer Not waren… und weil er tief von dieser gewaltigen Persönlichkeit beeindruckt und sicherlich glücklich war, von diesem als Freund angesprochen zu werden. Glondys hatte nicht viele Freunde.”
Die Originalhandschrift von Richters Sechster Symphonie ist bis heute verschollen geblieben. Im Nachlass des Komponisten befand sich nur eine einzige Orchesterpartitur, die noch Richter selbst auf einer Notenschreibmaschine angefertigt hatte. Es handelt sich dabei um einen (von wahrscheinlich mehreren) Durchschlägen, auf sehr minderwertiges Papier geschrieben und überaus schwer lesbar. Allein die „Qualität” der verwendeten Papiersorte lässt die damalige „wirtschaftliche Misere” ahnen. Von dieser praktisch unbenutzbaren Partitur hat der damals noch junge und spätere weltberühmte siebenbürgisch-sächsische Dirigent Erich Bergel 1957 eine gut lesbare handschriftliche Kopie angefertigt. Auch diese wurde, zusammen mit dem gesamten künstlerischen Nachlass Paul Richters, von dessen Sohn Wilhelm Richter 1974 dem Kronstädter Musikmuseum Casa Mureșenilor überlassen.
Erich Bergel (1930-1998) hatte bereits 1956 mit der Großwardeiner Staatsphilharmonie Richters Dritte Symphonie in g-Moll op 62 aufgeführt und sich öffentlich über Paul Richter – der siebenbürgische Sinfoniker geäußert (Neuer Weg Bukarest, 04.1.1957). Dass er sich der Mühe unterzog, eine leserliche Partitur von Richters Sechster Symphonie (ebenfalls in g-Moll, aber ohne Opuszahl) zu erstellen, geschah höchstwahrscheinlich auch in der Absicht, diese Symphonie irgendwann einmal aufzuführen. Die maschinenschriftliche Partitur hatte Bergel von Richters Witwe geliehen und von ihr auch erfahren, dass die Symphonie Bischof Viktor Glondys gewidmet sei. Bergel schätzte das Werk in einem weiteren Zeitungsartikel (Über Paul Richters unbekannte sechste Symphonie, Neuer Weg Bukarest, 30.5.1957) als Richters „Schwanengesang”, als sein „reifstes Werk” mit „programmatischem Inhalt” ein, aber ganz bewusst ohne jede konkrete Bezugnahme auf Text oder biographischen Hintergrund. Erich Bergel hatte schon als Student des Klausenburger Konservatoriums erfahren müssen, dass Musik mit derartigen Texten den damaligen politischen Machthabern eine willkommene Angriffsfläche bot. Das sollte sich im April 1959 erneut bestätigen, als Bergel (inzwischen Chefdirigent der Klausenburger Staatsphilharmonie) verhaftet und eingekerkert wurde, wegen „Verbreitung von religiösem Mystizismus mit Hilfe der Musik” (Hans Bergel: Erich Bergel, Ein Musikerleben, Gehann-Musik-Verlag Kludenbach, 2006, S. 40). Nach seiner 1962 erfolgten Entlassung durfte er zwar ab 1966 wieder öffentlich auftreten (als Folge eines sensationellen Einspringens für einen plötzlich erkrankten amerikanischen Dirigenten), aber Paul Richter hat er nie wieder aufgeführt. 1971 flüchtete er in die Bundesrepublik Deutschland und galt bis zur Revolution von 1989 in Rumänien als „Unperson”, deren Name nicht in der Öffentlichkeit zu erscheinen hatte. So musste in oben erwähnter Monographie auch jeder Hinweis auf Erich Bergel unterlassen werden.
Der Sinn obiger Ausführungen besteht darin, die notwendigen Ergänzungen zur erwähnten Monographie zu bieten, auch in der Hoffnung, damit das Interesse für Richters letzte Symphonie zu wecken.
Aber im Laufe der letzten dreißig Jahre haben mich auch immer öfter Zweifel an meiner ehemals formulierten Einschätzung dieser letzten Symphonie Paul Richters beschäftigt und die Verpflichtung reifen lassen, das Werk nochmals einer gründlichen Analyse zu unterziehen. Dank uneigennütziger Unterstützung von Kurt Philippi konnte ich aus dem Kronstädter Musikmuseum Casa Mureșenilor eine Xeroxkopie von Bergels handschriftlicher Partitur erhalten und das Werk in Ruhe nochmals einsehen. Als Fazit kann ich aus heutiger Sicht sagen, dass die Symphonie auf keinen Fall ein künstlerisches Versagen darstellt (Monographie, S. 57), eher einen Tribut an die traditionelle viersätzige Symphoniegattung, wie Richter sie bereits in seiner ersten Symphonie erprobt und durch ein entsprechendes Saalprogramm verdeutlicht hat (Monographie, S. 59).
In der von Erich Bergel angefertigten Partiturabschrift lässt sich deutlich erkennen, dass Richter Vortragshinweise, wie Phrasierungs- und Artikulationszeichen sowie Dynamikvorschriften, je näher er sich dem Ende nahte, umso spärlicher eingetragen hat. Im letzten Satz fehlen sie sogar ganz. Vielleicht waren diese in der Originalhandschrift vollständig vorhanden, nur hat Richter es während der Arbeit an seiner maschinenschriftlichen Kopie unterlassen, auch diese einzutragen. Das beeinträchtigt aber keinesfalls eine mögliche Aufführung, denn Richters Intentionen sind genügend klar zu erkennen.
Der erste Satz ist eine breit ausgeführte Sonatenform mit bereits erwähntem Chorabschluss. Im zweiten Satz in c-Moll klagt eine Solo-Bratsche, von trauermarsch-ähnlichen Rhythmen begleitet. Diese beiden Sätze wiegen am schwersten im Gesamtgefüge der Symphonie. Sowohl Chor im Kopfsatz und Solo-Bratsche im zweiten sind vorbildlose Gestaltungsweisen der viersätzigen Symphoniegattung und unmittelbarer Ausdruck von Richters seelischer Verfassung in jenen tragischen Jahren.
Es fällt schwer, nach diesen beiden programmatisch geprägten Sätzen zwei optimistisch-heitere Sätze als natürlichen Weiterverlauf zu empfinden. Auch Richter selbst scheint es Überwindung gekostet haben, eine Fortsetzung zu finden. Der Zuspruch von Bischof Glondys hat ihn dann offenbar doch ermutigt, alle Kräfte aufzubieten, um dem Kontrastgebot traditioneller viersätziger Symphonien folgen zu können: „Ich wünsche Dir für das Scherzo die Kraft… die sich in göttergleicher Kraft über alles drückende Irdische hinwegsetzen kann… Ich las von Rem-brandt, dass er es konnte...” (Brief vom 6.5.1947 aus Richters Nachlass, in der Monographie S. 57 zitiert). So entstand ein Scherzo (ital. Scherz, Spaß) in einer fast ebenso langen Aufführungsdauer wie der erste Satz. Das sicher mit Leichtigkeit in einem Zug komponierte Marsch-Finale, auch mit hymnenartigen Klängen, beschließt Richters letztes Werk. Da Richter keine Worte gefunden hat für ein Chor-Finale wie im ersten Satz, ist in der Monographie nur zu lesen: „die Hoffnung ist da, aber der Glaube fehlt.” Der Vergleich mit Beethovens Neunter Symphonie (Monographie, S. 57), im Hinblick auf ein denkbares, ja sogar erwartetes, Chorfinale ist in diesem Fall allerdings sehr zu hoch gegriffen.
Jenseits aller möglichen Erwartungen oder Vergleiche aber bleibt Richters Sechste Symphonie das erschütternde Zeitzeugnis einer begnadeten schöpferischen Persönlichkeit, die an ihrem Lebensende gezeichnet war durch Krankheit, Verlust zweier Kinder und wirtschaftlicher Not und dem man, im Falle einer Aufführung, mit Anteilnahme und liebevollem Verständnis entgegenkommen darf.