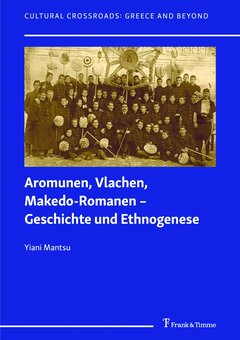Die starke Gemeinschaft der Aromunen aus vielen Ländern des Balkans, wie Albanien, Griechenland, Nordmazedonien, Rumänien und Bulgarien, die alle dieselbe Sprache sprechen, ihre Tradition pflegen und sich zur Ethnie der Aromunen bekennen, haben lange gekämpft für sprachliche Anerkennung, für ihre Gleichberechtigung in den Ländern, in denen sie leben und auch für Eigenstaatlichkeit, die ihnen bisher aber nicht gewährt wurde. Yiani Mantsu, von Geburt ein Aromune aus Rumänien, dessen Vorfahren in der rumänischen Dobrudscha nach Vertreibung angesiedelt wurden, hatte sich nach seinen erfüllten Berufsjahren als Ingenieur in der Automobilindustrie im Studium der Archäologie und Ethnologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland, dem Thema der Kultur, Herkunft und Geschichte seines Volkes in seiner Bachelor- und Masterarbeit gewidmet. Schließlich hat er seine Recherchen und Erkenntnisse in diesem Buch gesammelt und erweitert mit zahlreichen Abbildungen, Karten, Literaturverzeichnissen und Archiv-Dokumentensammlungen. Das Buch dokumentiert und beantwortet für die interessierten Leser die Frage: Wer sind die Aromunen und woher kommen sie?
Yiani Mantsu liefert in acht Kapiteln neben zahlreichen wissenschaftlichen Daten und Abhandlungen viele eigene Antworten zur Geschichte des Volkes der Aromunen, angefangen vom historischen Hintergrund, dem kulturellen und ethnopolitischen Aspekt nach den Kriegen auf dem Balken, seinem heutigen Status bis hin zum „Streit um den Namen ‚Mazedonien‘“.
Bereits im Vorwort beschreibt er die Absicht seines Buches: Es behandelt Kultur und Geschichte der Aromunen vor und nach den Balkankriegen von 1912/13 und berücksichtigt die Ergebnisse seiner ethnografischen Untersuchungen, die aus einer zweimonatigen Feldforschung im Sommer 2018 stammen, bei der fast 35 Stunden Audioaufnahmen bei den Aromunen in Albanien entstanden sind. Er hat außerdem ethnografische Daten aus mehr als zwanzig Siedlungen erhoben, teils mit ausschließlich aromunischen Audioaufnahmen aus den letzten Jahren, in Griechenland und Nordmazedonien mit Zeugen aus der Bevölkerung. Schilderungen der Umsiedlung und Vertreibung der Aromunen nach den Balkankriegen von 1912/13 und dem griechisch-türkischen Krieg von 1919–1922 sind eingeflossen. Somit wird hier die Geschichte der Aromunen erörtert, eine Geschichte, in der die Nationalstaaten des Balkans bestimmend waren in der Assimilation dieses Volkes. Das Buch jedoch zeigt, dass die Aromunen aus heutiger Sicht Teil einer vormodernen europäischen Gesellschaft waren, wie am Phänomen Moschopolis zu sehen ist. Der Autor will beweisen, dass dieses Volk der Aromunen zu den Europäern zählt und auch seine Kulturgüter zu den europäischen Kulturgütern gehören.
Verschiedene Namen für ein Volk
Um aber einen Einstieg in diese vielseitig komplexe Lektüre zu erlangen, erklärt der Autor gleich zu Beginn, woher der Name Aromune stammt: „…ein Leipziger Produkt, das vom deutschen Gelehrten Gustav Weigand von der Leipziger Universität Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt wurde und das Endonym Arman wiedergeben sollte – weist auf die romanischsprechende Bevölkerung mit südbalkanischer Herkunft hin.“ (S. 35) Bereits 1895 hatte Weigand seine Monografie „Über das Volk der sogenannten Makedo-Romanen“ veröffentlicht. Wie der Buchautor in der Fußnote erklärt, hatte der Begriff „Arumäne“ (rum. aromân) vorgeschlagen von einem Schüler Weigands in Rumänien, Sextil Puscaru, sich im Deutschen nicht durchgesetzt im Gegensatz zu anderen europäischen Sprachen. Das Fehlen eines eigenen Nationalstaates der Aromunen hatte zur Folge, dass das Volk in den verschiedenen Nationalstaaten, in denen es heute lebt, verschieden bezeichnet wird. Interessanterweise nennt man sie in Griechenland Ellino-Vlachen, Koutzovlachen, in Serbien Cincaren, in Bulgarien Vlasi, in Rumänien neben Armani, Medoni oder in Albanien, Coban Llacifaci (das auf den aromunischen Begriff: Wie geht es Onkel? Lali tsi fatsi?) zurückzuführen ist. Mantsu erklärt auch den Unterschied zwischen dem Begriff: Walachen (Bevölkerung nördlich der Donau) im Deutschen oft benutzt und Wlach für die Aromunen südlich der Donau. Auch im Deutschen kennt man den Ausdruck Walachen, aber wohl kaum die Unterschiede und Ethnogenese des Wortes, das oft abwertend gebraucht wird. Außerdem werden die Aromunen (Wlach) auch Makedo-Romanen genannt, um sie in der Balkanlatinität von der norddanubischen Balkanlatinität (Rumänen) zu unterscheiden. (S. 37)
Aromunisch: Kein Dialekt des Rumänischen
Im weiteren Kapitel der Ethnogenese stellt der Autor die verschiedenen Theorien, Hypothesen zur Herkunft der Aromunen gegenüber und kommt zu dem Schluss, dass die rumänische Ethnogenese der Aromunen, welche die Einwanderungstheorie (Kontinuitätstheorie) ist, seiner Meinung nach nicht nachvollziehbar sei. Unter Bezugnahme auf verschiedene Historiker und Forschungsergebnisse zur Ethnogenese der Aromunen, die sich stark voneinander unterscheiden, befürwortet der Autor die Theorie, dass die „… Aromunen einen von den drei südlich der Donau romanisierten Bevölkerungsteilen …, deren Sprachen mit Dako-Romanischen (dem heutigen Rumänien) zwar verwandt, ‚aber doch unterscheidbar sind: das Makedo-, Istro und Megleno-Romanische‘…“ bildeten. Sie gehören schlussfolgernd zu den „drei südlich der Donau romanisierten Volksgruppen“ (S. 44). Als Folge dessen erklärt Mantsu auch im Kapitel „Aromunisch: Eigenständige Sprache oder Dialekt des Rumänischen“, dass die aromunische Sprache, die nachweislich seit etwa dreihundert Jahren geschrieben wird, keinen Dialekt des Rumänischen darstellt, sondern vielmehr eine eigenständige Sprache ist, die sich in vielen Jahrhunderten entwickelt und im 20. Jahrhundert, wie von einigen europäischen Wissenschaftlern (Hans-Martin Gauger, Wolfgang Dahmen, Thede Kahl u.a) behandelt, als eigene Sprache behauptet habe. Der Autor sieht eher die Theorie des Historikers Dahmen als akzeptierbar, der schreibt, dass das Aromunische kein „Dialekt“ des Rumänischen, sondern des Balkanromanischen sei. Er weist dies mit Beispielen nach und schlussfolgert mit dem Satz: „Die aromunische Sprache – wie auch jede andere – ist der Spiegel, worin sich das Volk, das sie spricht, sein geistiges und materielles Leben vorhält…“ (S. 55)
Pastorale Transhumanz, aber keine Nomaden
Über die räumliche Verteilung der Aromunen und die Entwicklung der Gesellschaft von einer pastoralen Gesellschaft hin zum Bürgertum werden auch hier die verschiedenen Theorien vom Autor erläutert und die Zusammensetzungen der Zahlen aromunischer Gesellschaften erläutert. Für Rumänien wird die Ansiedlung der Aromunen im Cadrilater (das Gebiet der sogenannten Süd-Dobrudscha, heute Bulgarien, zwischen Schwarzem Meer und der Donau im Nordwesten begrenzt, Anm. d. Autorin) 1924/25 und 1940 die Umsiedlung vom Cadrilater nach der rumänischen Dobrudscha erklärt. Auch mit der ewigen Streitfrage der Aromunen, die „Gegenstand eines Konfliktes zwischen Griechenland und Rumänien… auch ein Teilproblem der Makedonischen Frage und insofern Objekt der Balkanpolitik der Großmächte“ ist, werden Argumente und Gegenargumente ausgetauscht. (S.55)
Eine weitere „Legende“ widerlegt Yiani Mantsu in seinem Buch im 3. Kapitel „Historischer Hintergrund der Aromunen – Von pastoraler Transhumanz zum aromunischen Bürgertum“, nämlich, dass dieses Volk wegen seiner traditionellen Beschäftigung oft in der Fachliteratur als Nomadenvolk abgestempelt wird. „Der Geograf Simion Mehedin]i fällt daher in der Einleitung zu der Monografie des Historikers Anastase Hâciu ein klares Urteil über Verhältnis von Nomadismus und pastoraler Transhumanz: ‚Es ist wahr, dass sie (die Aromunen) große Schafherden besaßen, die sie im Herbst von Gebirgen ins Tiefland bewegten, wie es auch die Hirten in Italien, Provence, Spanien oder anderen Nachbarländern des Mittelmeeres tun. Das ist die Transhumanz, und zwischen Transhumanz und Nomadismus liegt ein sehr langer Weg, wie von der Erde bis zum Himmel.‘“ (S. 56) Folglich ist für Mantsu die Annahme vieler Wissenschaftler, die Aromunen als nomadisches Volk zu betrachten, nicht nachvollziehbar. Wenn „von ehemaligen Wanderhirten mit saisonaler Transhumanz“ gesprochen wird, kann man nicht gleichweg „dieses ethnisch gebundene Nomadentum“ benutzen für das aromunische Volk. Da man unter Transhumanz „eine jahreszeitliche Wanderung von Weidetieren (zumeist Schafherden) zwischen den Sommerweiden im Gebirge und den Winterweiden im Tiefland, die durch das Mittelmeerklima im südosteuropäischen Raum bestimmt wird: trockene Sommer und feuchte, milde Winter für die Tiefländer (versteht). Die Transhumanz-pastoralen Gesellschaften sind sesshafte Gesellschaften, die keine autarken und geschlossenen Systeme bilden. Bei solchen ethnischen Gruppen sind die Interaktionen mit nicht pastoralen Gruppen nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch im kulturellen und ideellen Bereich wichtig und sogar notwendig“, schlussfolgert Mantsu in diesem Kapitel (S. 57).
Karawanenführer für Handels-transporte
Denn nicht nur als Schafhirten waren sie unterwegs, sondern auch in anderen Wirtschaftszweigen haben sie aktiv gewirkt und waren ein wichtiger Faktor im militärischen Bereich. „Bereits seit dem sechsten Jahrhundert, als Latein Amtssprache war, dienten die Vorfahren der Aromunen als Karawanenführer nicht nur in der Armee, sondern auch für die Handelstransporte von Westen nach Osten. Daraus erwuchs auf der ganzen Balkanhalbinsel der große aromunische Handel.“ (S.59)
Leider haben in der Forschung im Westen die meisten Wissenschaftler mehr Interesse am Leben dieser Hirten (in all seinen Formen) gezeigt und haben Leben und Wirken jener städtischen Aromunen vernachlässigt, die in Industrie, Handel, Transportmittel und Finanzen in Bewegung tätig waren. „Das Ende des ersten Jahrtausends“ – so die Feststellung des Historikers Anastase Hâciu – fiel mit der „vollständigen Bildung eines aromunischen Volkes“ zusammen, als sich ein aromunisches Bürgertum entwickelte, das sich mit Geschäften befasste und enge Beziehungen zum Westen pflegte. Die Existenz vieler Handelskontore am Mittelmeer bezeugt dies, und die Figur des aromunischen Karawanenführers wird immer deutlicher und spielt bereits anfangs des 11. Jahrhunderts eine sehr wichtige Rolle im Wirtschaftsleben der Balkanhalbinsel.“ (S. 58)
Namhafte Persönlichkeiten
Dass die Vertreter der Aromunen auf zahlreichen Gebieten sich einen Namen machten, entnehmen wir denvielen Beispielen von Persönlichkeiten aus dieser Minderheit, die auch im Buch genannt werden, wie etwa Dimitrie Cosacovici aus Aminciu (Metsovo, Griechenland), der im Dienst der rumänischen Regierung im 19. Jahrhundert tätig war oder der rumänische Prinz Albert Ghica, der gemeinsam mit anderen Vertretern seiner Adelsfamilie eine wichtige Rolle in der modernen Entwicklung Rumäniens spielte, der Gelehrte Anastase Haciu, die aromunische Dichterin Kira Mantsu, die Gelehrten, Historiker und Buchautoren Valeriu Papahagi, Adrian Papahagi, Tache Papahagi, der ein aromunisches Wörterbuch erstellt hat u. viele andere, Architekten, Künstler und Personen des öffentlichen Lebens.
Balkankriege als Wendepunkt
Neben den sprachlichen Herkunftstheorien, der Irade (Erlass des Sultans für die Anerkennung der Vlachen, Aromunen als eigenständige Nation im Osmanischen Makedonien), um die aromunische Bevölkerung zu schützen, über die Kirchen- und Schulpolitik, den Unterricht in ihrer eigenen Sprache in Makedonien im 19. Jahrhundert, über die Kirchenfrage, die Gründung eines aromunischen Episkopats, werden die verschiedenen Geschehnisse ausführlich dargelegt und belegt. Ein Unterkapitel beschreibt schließlich den Wendepunkt in der Geschichte der Aromunen: die Zerstörung von Moschopolis (heute Voskopoje in Albanien, S. 79).
Weitere Eingriffe in die Souveränität der Aromunen wie auch der aromunischen Sprache thematisiert der Autor auch in seinen nächsten Kapiteln, wo er über die kulturellen und ethnopolitischen Aspekte der Balkankriege spricht und zu den Friedensverhandlungen in Bukarest von 1913, als die Aromunen „überhaupt nicht erwähnt“ wurden (S. 130) und ihre Rechte als Minderheit somit nicht beachtet wurden. Mantsu schlussfolgert, dass die Balkankriege den Wendepunkt auch in der mazedonischen Geschichte damals waren, „durch die Aufteilung Makedoniens auf die vier Balkanstaaten Griechenland, Serbien, Bulgarien und Albanien. Schließlich lenkt der Autor die Aufmerksamkeit auf die Verstreuung der Aromunen nach den Balkankriegen: als sie 1940 aus dem Cadrilater wieder umgesiedelt werden mussten, da dieses Gebiet an Bulgarien zurückgegeben wurde. Siebentausend aromunische Familien wurden aus dem Cadrilater abermals umgesiedelt nach Rumänien, obwohl sie erst ab 1925 von Makedonien in den Cadrilater gesiedelt hatten. Sie wurden zum „Spielball nationalistischer Bevölkerungspolitik“ (139) Der Leser erfährt auch, dass die Aromunen durch dieses Hin und Her in ihrer Geschichte, eine große räumliche Verteilung erfahren haben, die bis heute anhält. „Von den mehr als 700 Siedlungen mit aromunischem Bevölkerungsanteil aus dem geografischen Raum der Untersuchung befanden sich nach den Balkankriegen mehr als 200 in Albanien, mehr als 400 in Griechenland und mehr als 100 in Südserbien.“ (S.139) Durch die Zwangsumsiedlung der Aromunen nach Rumänien 1913 zählen sie heute „… geschätzt 100.000-150.000“ Bürger in der rumänischen Diaspora. (S. 143). Nach den Balkankriegen und dem Friedensvertrag von Bukarest war – laut Autor – das aromunische Volk in sechs Nationalstaaten verteilt.
Quelle der Zwie-tracht für Rumänien und Griechenland
Die Schlussfolgerungen und der heutige Status der Aromunen wird schließlich im 6. Kapitel erläutert: in Albanien und Griechenland werden sie nicht als nationale Minderheit anerkannt, jedoch seit 1991 in Nordmazedonien. Obwohl der Europarat mit einer Empfehlung 1997 die Balkanstaaten ermuntert, die aromunische Gemeinschaft als Minderheit anzuerkennen sowie ihre Sprache, Kultur und Kirche zu unterstützen, werden die Aromunen auch in Rumänien nicht als Minderheit anerkannt und unterstützt und gefördert wie andere Minderheiten des Landes.
Schließlich wird im 6. Kapitel über den heutigen „Status der Aromunen auf dem Balkan“ die neue Diskussion über die Identität der Aromunen nach 1990/91 behandelt und die Lage des Volkes in den einzelnen Staaten angesprochen. Dabei ist zu beachten, dass in Griechenland die Aromunen „nach wie vor als Teil der griechischen Nation“ gelten. (S. 147). Mantsu thematisiert dann im 7. Kapitel die „Beilegung des Streits um den Namen „Mazedonien“ – ein komplexes Thema um die Zugehörigkeit und den Namensstreit Mazedoniens und der „mazedonischen Sprache“. Schlussfolgernd auf all diese Unwägbarkeiten betreffend die Aromunen stellt der Autor fest, dass „die Aromunische Frage war und wird für immer ein Apfel der Zwietracht zwischen Rumänien und Griechenland bleiben. Von beiden Ländern wird sie als Werkzeug für politische Zwecke benutzt...“ (S. 166).
Mantsu, der auch Zugang zu Geheimdienstakten gesucht hat für seine Beweise, weist interessanterweise daraufhin, dass es nach 1991 Rumänien und Griechenland eine „verbale Note“ (Vereinbarung bei einem Treffen in Thessaloniki) gab, dass Griechenland den Präsidentschaftswahlkampf der Rumänen unterstützte, wenn diese sich nicht in die aromunischen „Angelegenheiten Griechenlands“ einmischen. (S. 166). Interessant, aber nur eine von vielen in diesem Buch aufgezeigten ungerechten Behandlungen und Ausgrenzungen dieser historisch gewachsenen Nation mit einer eigenen Sprache und Kultur. Somit bleiben die Aromunen in den sechs Balkanländern eine Nation, denn sie erfasst für sie „ihr Wesen“. (S. 166) Trotz der Empfehlung 1333 des Europarats von 1997 für den Schutz der aromunischen Sprache sowie einer Bürgerinitiative der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) hat sich kaum etwas bewegt.
Das Buch von Yiani Mantsu schließt ab mit einem umfassenden Literaturverzeichnis, Register sowie zahlreichen Landkarten, was allein schon eine Anregung sein kann, sich weiter mit der Frage der Aromunen zu beschäftigen. Deswegen empfehlenswert ist die Lektüre nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für Neugierige der Geschichte Europas und besonders Osteuropas.
In dem schönen Ort Metsovo im Pindosgebirge, Aminciu auf aromunisch, werden jährlich zahlreiche Feste der Aromunen ausgetragen, wenn sich Vertreter aus allen Teilen des Balkans versammeln. Um ihre Traditionen, Sitten, Gebräuche und das Fortbestehen zu erhalten, sind auch die heutigen Generationen von jungen Aromunen aus allen fünf Balkanstaaten immer eifrig dabei bei diesen Treffen. Die Trachten, Tänze und Feste der Aromunen sind farbenfroh, heiter und auch gläubig behaftet. Zwischen den Bergketten des Pindos erschallt im Sommer die Musik und der Gesang der Aromunen. Zahlreiche Gäste und Besucher schmücken die Reihen der Neugierigen des Ortes, der sich malerisch einfügt in die Gebirgsketten des Pindos der Region Epirus, auf etwa 1160 Metern Höhe gelegen, und umgeben wird von vielen anderen kleinen Dörfern, in denen immer noch Vertreter der Aromunen leben.
Fotos: Katharina Kilzer
Yiani Mantsu: Aromunen, Vlachen, Makedo-Romanen – Geschichte und Ethnogenese Cultural Crossroads: Greece and Beyond, Band 3; Aromunen, Vlachen, Makedo-Romanen – Geschichte und Ethnogenese - Verlag „Frank & Timme“; ISBN 978-3-7329-1063-2 , 2024. Taschenbuch, broschiert, Seiten 208; Kulturwissenschaften, Preis 39,80 Euro